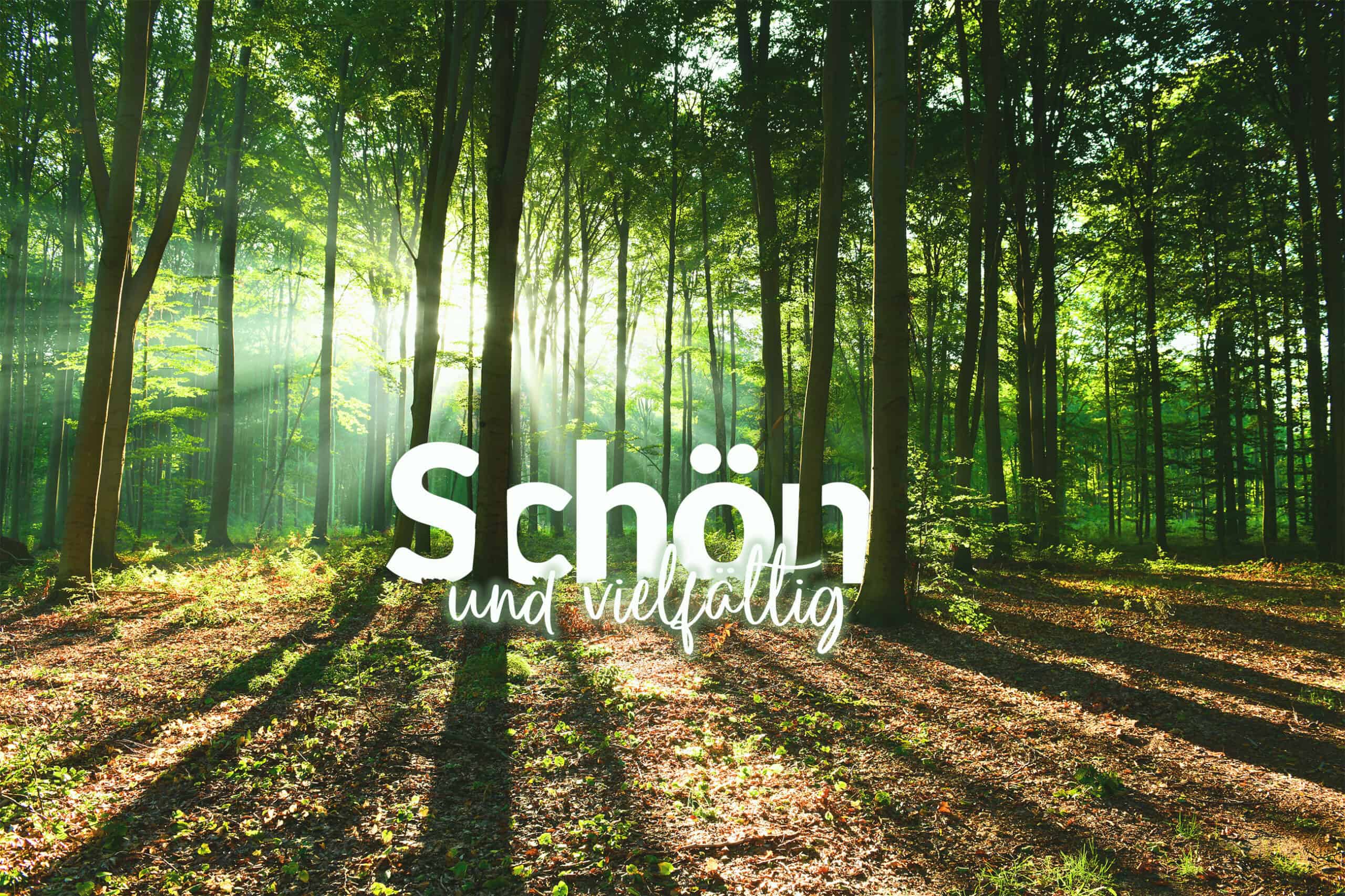© 2025 Adobe Stock, Michal
© 2025 Adobe Stock, Michael Thaler
Von den Tälern bis zum Hochgebirge – Tiere im österreichischen Wald
Es ist wie eine Reise durch verschiedene Lebensräume: Bei einer Wanderung vom bewaldeten Talboden bis hinauf ins Hochgebirge durchqueren wir in Österreich unterschiedliche Lebensräume. In den tieferen Lagen der Berge begegnen uns noch viele der Tiere, die auch im Flachland heimisch sind. Je höher wir dann steigen, desto rauer wird das Klima und desto weniger zahlreich werden die Tierarten. Und jedes Tier, dem wir unterwegs begegnen, ist vollkommen an seinen Lebensraum angepasst. Jede Höhenlage – vom grünen Tal bis zur kargen Gipfelregion – birgt tierische Besonderheiten, die wir mit etwas Geduld und offenen Sinnen entdecken können, wenn wir nur genug hinschauen und natürlich etwas Glück haben..
Tiere im Tal
Im Tal und am Waldrand bis etwa 800 Meter Höhe leben besonders viele Tiere. Rehe und Hirsche findet man überall – vom Flachland bis hoch in die Berge, wo die Bäume aufhören zu wachsen. Der Rothirsch liebt große, offene Wälder, lebt aber eigentlich überall in Europa – von den Wäldern an Flüssen bis zu den Bergen. An der Donau werden die Hirsche besonders groß und kräftig. Unser Tipp: In der Dämmerung lassen sich Rehe mit etwas Glück beim Äsen, also beim Fressen, auf Waldwiesen beobachten. Und der Nationalpark Donau Auen bietet nächtliche Ausfahrten auf der Donau an. Mit etwas Glück hören Gäste hier die eindrucksvollen Hirschrufe.
© 2025 Adobe Stock, Vaclav
© 2025 Adobe Stock, lightpoet
Weitere Bewohner von Talwäldern sind Wildschweine. Tagsüber verstecken sich die schwarzgrauen Tiere meist tief im Unterholz, nach Einbruch der Dunkelheit kommen sie hervor. Vielleicht entdeckt man am Morgen ihre Spuren: umgepflügte Erde, die sie mit ihren kräftigen Schnauzen den Boden nach Eicheln und Wurzeln durchwühlt haben. Leise sein heißt es hier, wenn man Wildschweine oder andere scheue Waldbewohner sehen will – meist hören sie uns Menschen lange, bevor wir sie erblicken.
Wem wir noch begegnen können, ist der Rotfuchs. Er ist ein echter Überlebenskünstler und nicht nur in dichten Wäldern anzutreffen. Manchmal sieht man ihn in Parks und sogar am Stadtrand. Nachts hört man manchmal seinen Ruf und mit etwas Geduld kann man seine Silhouette unter dem Mondlicht erspähen. Für neugierige Naturbeobachter lohnt es sich, auf leuchtende Augenpaare im Schein der Taschenlampe zu achten: Oft sind es Füchse, die da zurückschauen, oder auch eine Eule.
© 2025 Adobe Stock, Dario
© 2025 Adobe Stock, Patrik
Neben diesen größeren Tieren ist der Talwald voller kleiner Wunder: Eichhörnchen turnen in den Ästen, am Morgen beginnt vielstimmiges Vogelgezwitscher. Im Frühling hört man an Waldteichen das Quaken der Frösche. Sogar ein funkelnd blauer Eisvogel kann an Bachufern durch den Auwald schießen. Die Vielfalt im Tal ist groß, denn hier sind Klima und Nahrung reichlich. Es ist ein Paradies für Tiere und für aufmerksame Wanderer gleichermaßen.
Tiere im Bergwald
Je höher man den Berghang hinauf wandert, desto stiller und urtümlicher wirkt der Bergwald. Wir sind hier auf 800 bis 1500 m Höhe. Die Bäume – nun oft Tannen, Fichten und Lärchen, teils noch Buchen –, lassen häufig nur grünes Dämmerlicht auf den moosigen Waldboden fallen. Hier oben, in den mittleren Höhenlagen, lebt der König des Waldes: der Rothirsch. Er fühlt sich in Lichtungen mit jungem Gras am wohlsten. Meist bleibt das größte heimische Wildtier Österreichs dem Wanderer verborgen, doch im Herbst verrät er sich: Wenn an nebeligen Septembermorgen das mächtige Röhren eines Hirsches durch den Wald hallt, ist Brunftzeit. Dieses urige Schauspiel, bei dem die Hirsche um die Gunst der Weibchen kämpfen, sorgt für Gänsehaut-Stimmung bei allen, die es hören dürfen.
Aber: Rothirsche steigen sie im Sommer sogar auf bis über 1.800 m oder sogar 2.000 m hinauf. Damit sind sie oft oberhalb der Baumgrenze.
Im Bergwald findet auch der Rotwild-Nachwuchs Schutz: Hirschkühe ziehen sich mit ihren Kälbern tagsüber tief in den Wald zurück. Wer aufmerksam am Waldboden sucht, entdeckt vielleicht Fährten der Hirsche oder ihre Losung (ovale „Kotpillen“). Auch Rehe gibt es noch in diesen Höhen. Wer geduldig ist, sieht sie an lichten Waldrändern oder ruhigeren Hängen äsen. Gegen Abend kann man sie an Waldwiesen austreten sehen, immer wachsam lauschend.
© 2025 Adobe Stock, Manuel
© 2025 Adobe Stock, Rudi Reiner
Ursprünglich zuhause in der Taiga in Nord- und Osteuropa, gilt der Anblick eines Auerhuhns bzw. -hahns heute als Glücksfall. Der größte Wildhuhn-Vogel Europas ist extrem scheu und braucht ungestörte, alte Bergwälder mit Lichtungen. Am wohlsten fühlen sich diese Tiere zwischen alten Fichten, Kiefern und Beerensträuchern; Beeren zählen zu ihrer Lieblingsnahrung. Wer in der beginnenden Dunkelheit ein entferntes, gurrendes Gluckern und Schnalzen hört, könnte einen balzenden Auerhahn vernommen haben. Doch einen zu Gesicht zu bekommen, ist beinahe so unwahrscheinlich wie ein Lottogewinn: Das Auerhuhn ist in Mitteleuropa nur stellenweise heimisch und streng geschützt. Auch diese verborgenen Bewohner verleihen dem Bergwald einen Zauber: Man weiß, sie sind irgendwo, auch wenn man sie nur selten sieht.
Im Halbdunkel des Bergwaldes leben auch Dachs und Marder und hoch oben klopft der Schwarzspecht an morsche Stämme auf der Suche nach Ameisen. Wenn die Nacht hereinbricht, erfüllt das geheimnisvolle Schuhu-Rufen des Waldkauzes die kühle Waldluft. All diese Eindrücke machen eine Wanderung durch den Bergwald zu einem sinnlichen Erlebnis.
© 2025 Adobe Stock, monikasurzin
© 2025 Adobe Stock, liamalexcolman
Nicht zu vergessen sind die großen Beutegreifer, die einst hier heimisch waren: Wolf, Luchs und Bär. Im Nationalpark Kalkalpen sowie im Mühl- und Waldviertel hat sich wieder eine kleine Luchs-Population etabliert. Insgesamt leben in Österreich schätzungsweise 40 bis 50 Luchse. Bären sind meist Durchzügler aus Slowenien bzw. Italien. Und Wölfe gibt es seit einigen Jahren wieder vereinzelt bzw. in kleinen Rudeln. Die Chance, einem dieser scheuen Räuber zu begegnen, ist allerdings verschwindend gering. Dennoch: Zu wissen, dass irgendwo tief im Wald ein Luchs durch die Dämmerung schleicht oder dass in entlegenen Winkeln vielleicht wieder ein Wolf heult, zeugt von der wilden Seele unserer Wälder, die nie ganz verloren gegangen ist.
An der Waldgrenze – wo der Wald endet
Irgendwann lichtet sich der Bergwald. Die Bäume werden niedriger, krummer und stehen weiter auseinander. Wir haben die Waldgrenze und damit auch die Baumgrenze erreicht – jenen Übergangsbereich, in dem der Wald allmählich in Almwiesen und Felslandschaft übergeht. Dort, wo die letzten Zirben im Wind stehen und Latschenkiefern die Böden bedecken, öffnet sich ein neues Panorama – und ein neuer Lebensraum. Je nach Region sind wir hier auf einer Höhe zwischen 1.500 und 2.200 Metern.
© 2025 Adobe Stock, Lunghammer
2025 Stock Adobe, Veronika
Gämse sind der Inbegriff dieses Übergangsgebiets. Sie fühlen sich im oberen Waldgürtel besonders wohl, steigen aber auch weit über die Waldgrenze hinaus, um zwischen Felsen nach Kräutern und Gräsern zu suchen. Ihr beige-braunes Fell und die schwarzen Gesichtsstreifen tarnen sie perfekt zwischen Fels und Gebüsch. Natürlich sind Gämsen in diesen Höhen erstaunliche Kletterer: Rasch und leicht überwinden sie schroffe Felspartien, wohin kaum ein menschlicher Kletterer folgen könnte. Oft leben sie in kleinen Gruppen. Wenn man leise ist und ein Fernglas dabeihat, kann man am frühen Morgen oder späten Nachmittag solche Rudel an steilen Grashängen beobachten – ein wahrhaft schöner Anblick in der klaren Bergluft.
Zwischen den letzten krummen Bergkiefern hört man plötzlich ein schrilles Pfeifen – als hätte jemand auf einer Trillerpfeife geblasen. Das Signal stammt von einem Murmeltier, das auf einem Felsen Wache hält. Diese niedlichen Nager sind wohl die bekanntesten Bewohner der Alpen und leben vor allem auf rund 1.200 m bis hinauf auf 2.500 m Höhe.
Oberhalb der Waldgrenze graben sie ihre weitverzweigten Baue in die weichen Almwiesenböden. Bei Sonnenschein sieht man Murmeltiere oft behaglich auf einem Felsblock liegen und sich das dichte Fell wärmen. Doch bei der kleinsten Störung stoßen sie ihren weithin hörbaren Alarmpfiff aus – dann huschen alle Familienmitglieder blitzschnell in ihre schützenden Erdhöhlen. Wer unterwegs also ein Pfeifkonzert der Murmeltiere hört, wurde bereits entdeckt!
Beobachtungstipp: Oft kann man mit etwas Geduld und Fernglas die Murmeltiere bald wieder aus ihren Löchern lugen sehen, wenn sie glauben, die Luft ist rein.
© 2025 Adobe Stock, Vašut Šimon
Die Vogelwelt an der Waldgrenze ist unscheinbarer, aber da: Mit etwas Glück kann man im frühen Sommer das Balzspiel des Birkhuhns beobachten. Die männlichen Birkhühner mit ihrem glänzend schwarzen Gefieder und dem roten „Augenkamm“ vollführen auf offenen Almlichtungen bei Sonnenaufgang spektakuläre Kämpfe, begleitet von gluckernden Lauten. Diese Raufußhühner sind typische Bewohner des Mittel- und Hochgebirges. Allerdings bekommen Wanderer sie nur selten zu Gesicht, denn ihre Bestände sind durch Lebensraumverlust und Störungen rückläufig.
© 2025 Adobe Stock, DoreenB
© 2025 Stock Adobe, Stephan
Nicht zu vergessen ist der Schneehase, der in der Zwergstrauchzone der Latschen und Felsen lebt. Er sieht etwas rundlicher aus als sein Vetter, der Feldhase, und trägt als besondere Anpassung im Sommer ein braunes Fell, im Winter aber ein schneeweißes. So ist er sowohl auf erdbraunen Bergwiesen als auch im Winterweiß der Schneefelder perfekt getarnt. Die nachtaktiven Schneehasen bekommt man nur selten zu Gesicht, am ehesten bemerkt man ihre Spuren im frischen Schnee. Schneehasen gelten als gefährdete Art, und die Wahrscheinlichkeit einer direkten Begegnung ist gering. Doch allein die Vorstellung, dass irgendwo im Kar ein Schneehase über die Felsen hoppelt, verleiht der Hochgebirgslandschaft etwas Magisches.
Im Hochgebirge – Leben über der Baumgrenze
Oberhalb der Waldgrenze entfaltet sich die raue Schönheit des Hochgebirges. Hier auf über 2.000 m Höhe dominieren Fels, Schutt und alpine Matten; Bäume sucht man vergeblich. Was auf den ersten Blick karg und leer erscheint, ist dennoch Lebensraum für einige hochspezialisierte Tiere. Alle Tiere über der Baumgrenze sind wahre Überlebenskünstler: Mit dichtem Fell oder Gefieder schützen sie sich vor starker UV-Strahlung und extremen Temperaturschwankungen. Einige wechseln sogar ihr Aussehen mit den Jahreszeiten – Schneehase und Schneehuhn zum Beispiel tragen im Winter ein weißes Kleid, als wären sie Teil des Schnees.
© 2025 Adobe Stock, Mario Hoesel
© 2025 Adobe Stock, Heiko Zahn
Das Mauswiesel wurde vom Naturschutzbund Österreich zum „Tier des Jahres 2026“ gewählt. Dieses winzige Raubtier zählt zu den flinksten und energiehungrigsten Bewohnern: Es ernährt sich fast ausschließlich von Kleinsäugern und kann beispielsweise an einem einzigen Tag ein Drittel seines eigenen Körpergewichts verspeisen.
Das Mauswiesel ist erstaunlich anpassungsfähig und kommt in Europa von Meereshöhe bis in die Bergregionen vor. Einige Quellen geben Höhenlagen bis etwa 2.000 Metern an. Andere Studien verzeichnen Vorkommen sogar bis etwa 3.800 Metern in extremen Gebirgsregionen. Man findet es in offenen Landschaften ebenso wie in naturnahen Wäldern. Seinen Unterschlupf findet es in Baumwurzeln, Erdspalten, Hecken, Baumlöchern und Steinhaufen.
Kurz gesagt: Es fühlt sich sowohl im Flachland als auch hoch oben in alpinen Bereichen wohl – solange ausreichend Nahrung und Deckung vorhanden sind.
Hoch oben auf einem Felssporn zeichnet sich im Morgenlicht die Silhouette eines Steinbocks ab. Mit majestätischer Ruhe stand er wohl die ganze Nacht dort oben auf dem Felsgrat. Der Alpensteinbock ist der unangefochtene Klettermeister der Alpen. In schwindelerregenden Höhen bis zu 3.500 m fühlt er sich zu Hause. Dort, zwischen der Waldgrenze und den Gletschern, findet er in Felsschroffen noch Flechten und Gräser zum Fressen. Im Sommer klettern Steinböcke scheinbar mühelos auf die steilsten Gipfel, während sie im Winter etwas tiefer ziehen, um der Kälte zu entgehen. Die eindrucksvollen gebogenen Hörner der Steinbock-Männchen erzählen von vielen harten Wintern: Jedes Jahr bildet sich ein neuer Horn-Abschnitt.
Wer auf einer hochalpinen Tour aufmerksam die Felsbänder absucht, kann mit etwas Glück einen ganzen Trupp Steinböcke entdecken. Meist liegen sie tagsüber träge auf einem Felsvorsprung und beobachten argwöhnisch die Umgebung. Tipp: Häufig halten sie sich in den Morgen- oder Abendstunden an Stellen mit salzhaltigem Gestein auf. Dort lohnt sich geduldiges Warten mit dem Fernglas. Wer eine Tour mit einem Nationalpark-Ranger bucht, hat gute Chancen, einen Steinbock zu sehen. Die Ranger kennen die Plätze und haben spezielle Spektive für Naturbeobachtungen dabei.
© 2025 Adobe Stock, Andreas Föll
© 2025 Countrypixel
Am Himmel über den Gipfeln zieht lautlos der Steinadler seine Kreise. Mit bis zu 2 Metern Flügelspannweite gehört er zu den größten Greifvögeln der Alpen. Man findet ihn in den Gebirgsregionen überall dort, wo es genug Beutetiere gibt – Murmeltiere, junge Gämsen oder Schneehasen stehen auf seinem Speiseplan. Wenn der Adler mit scharfem Schrei über den Tälern ruft, wirkt die Hochgebirgslandschaft noch ursprünglicher. Der Steinadler ist übrigens Österreichs Wappentier. Derzeit gibt es ca. 350 bis 400 Steinadler-Paare. Einen von ihnen in freier Wildbahn zu beobachten, zählt zu den eindrucksvollsten Naturerlebnissen überhaupt. Die Begegnungswahrscheinlichkeit ist gar nicht so gering: Oft lässt sich mit bloßem Auge ein kleiner dunkler Punkt hoch oben ausmachen, der weite Kreise zieht – mit dem Fernglas erkennt man dann den eleganten Segelflug des Adlers.
Ein viel geselligerer Vogel begleitet uns Wanderer häufig auf den höchsten Gipfeln: die Alpendohle. Diese schwarz gefiederte Bergdohle mit leuchtend gelbem Schnabel und roten Beinen ist gar nicht so scheu. In Höhen ab der Baumgrenze bis etwa 3000 m flattert sie in Scharen umher. Besonders um Berghütten und Aussichtsgipfel sind Alpendohlen Stammgäste – denn sie haben gelernt, dass es bei Menschen manchmal Futterkrümel abzustauben gibt. Sobald man sein mitgebrachtes Brot auspackt, sind die gewitzten Alpendohlen meist sofort zur Stelle. Allerdings sollte man sie aus Naturschutzgründen nicht füttern.
© 2025 Adobe Stock, Michael Schroeder
© 2025 Adobe Stock, Ben
Wer sich ganz leise verhält, vernimmt in der Stille des Hochgebirges vielleicht auch das Krächzen eines Kolkraben oder – seltener – das heisere Pfeifen eines Bartgeiers. Letzterer ist eine absolute Ausnahmeerscheinung: Mit annähernd 3 m Flügelspannweite gehört der Bartgeier zu den größten flugfähigen Vögeln der Welt. Dieser beeindruckende Aasfresser war in den Alpen einst ausgerottet, wurde jedoch wieder angesiedelt. Heute gibt es im gesamten Alpenraum mehr als 300 Bartgeier; ihn zu sehen ist ein seltener Glücksfall. Meist kreisen sie in felsigen Hochgebirgsgegenden oberhalb der Baumgrenze. Wenn sich plötzlich ein riesiger, fast lautloser Vogel am Himmel zeigt, der im Sonnenlicht rotbraun schimmert und langsam über die Felswände segelt, könnte es ein Bartgeier sein. Ein solches Erlebnis vergisst man nie – es ist, als ob man einen Blick in die Urzeit der Alpen täte.
Selbst hier oben zwischen den scheinbar lebensfeindlichen Felsen kann man Spuren von Tieren finden. Zwischen den Steinen krabbeln spezialisierte Insekten und Spinnentiere, und in Schneetümpeln schwimmen abgehärtete Bergmolche. Manchmal entdeckt man im hochalpinen Schnee sogar frische Fuchsspuren – tatsächlich durchstreift der schlaue Rotfuchs auch diese Höhen bis über 3000 m. Immer auf der Suche nach etwas Fressbarem, nicht selten in der Nähe von Bergsteigerhütten. Die Tierwelt des Hochgebirges ist einsam, aber sie ist da: Jeder Felsblock, jeder Schneefleck kann Leben verbergen.
© 2025 Adobe Stock, Calin Tatu
© 2025 Stock Adobe, Clemens
Wenn der Abend über den Gipfeln hereinbricht, senkt sich eine fast andächtige Ruhe. Im Winter kehrt dann endgültig Stille ein. Viele Tiere wandern in tiefere Lagen oder ziehen sich in ein schützendes Versteck zurück. Murmeltiere verschlafen die kalte Jahreszeit tief in ihren unterirdischen Bauen in wohliger Winterstarre. Dachs andere Tiere halten Winterruhe im Schutz des Waldes. Andere wie Schneehase und Schneehuhn bleiben den frostigen Höhen treu und trotzen der Kälte im weißen Tarnkleid. Und wenn ein strahlender Wintertag im Hochgebirge anbricht, ziehen wieder die Spuren der Wildtiere über die unberührten Schneeflächen – stille Zeugen dafür, dass auch in der scheinbaren Einsamkeit der Gipfel das Leben in vielfältiger Form weitergeht.
Zum Weiterlesen
Zum Nachlesen
Rechte & Produktion
© 2024 Die österreichischen Familienwaldbetriebe & Österreichischer Forstverein – Unterstützt durch den Holzinformationsfonds der Landwirtschaftskammer Österreich
Redaktion
Wir haben sorgfältig recherchiert und Informationen zusammengetragen. Wenn ihnen dennoch etwas auffällt, was sie ändern würden oder etwas zu ergänzen wäre, bitten wir sie, Kontakt mit uns aufzunehmen. Wir freuen uns über ihre Rückmeldung und Anregungen.