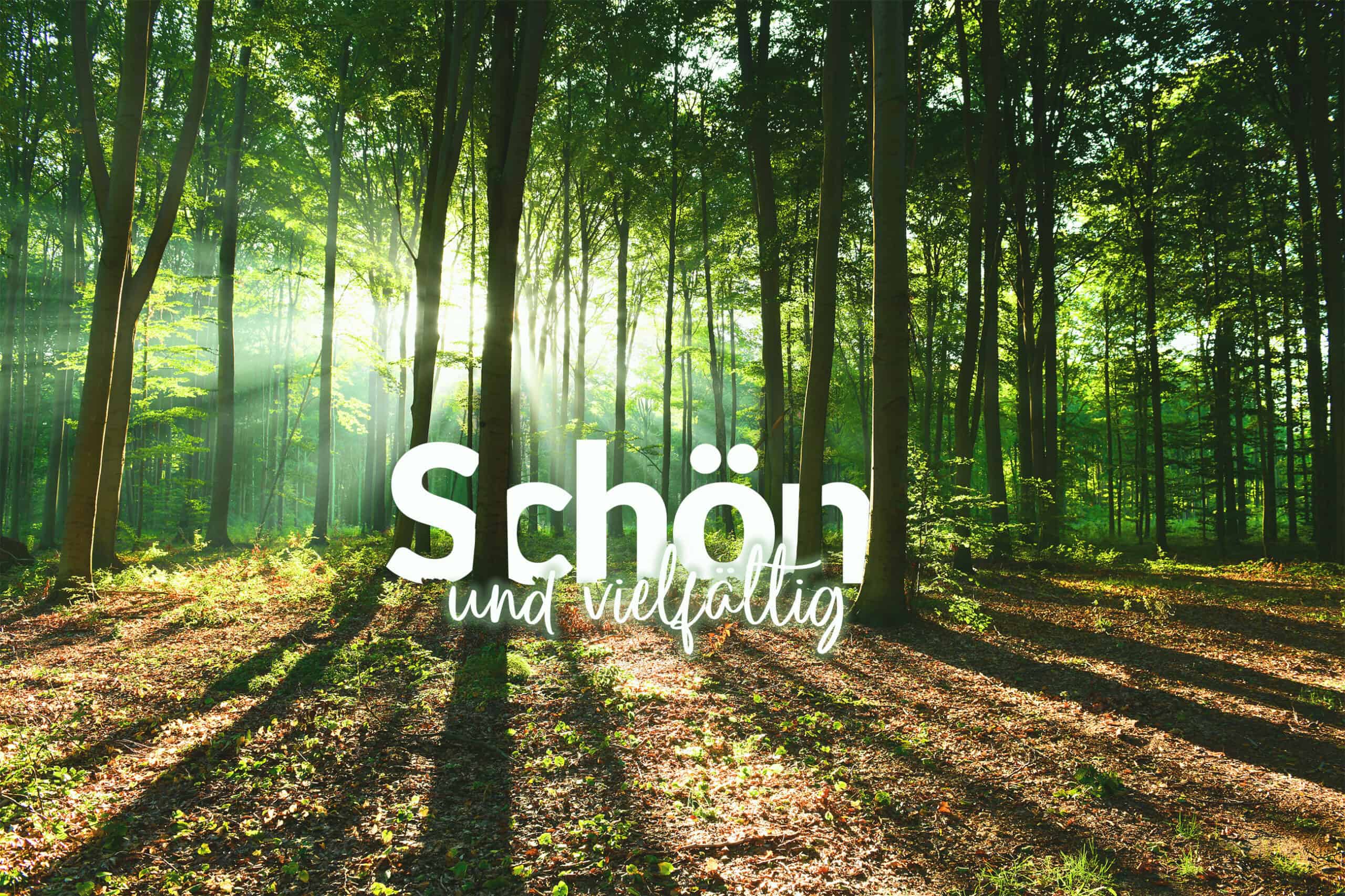Flechten im österreichischen Wald: Bedeutung, Funktionen, Gefährdung und Schutz
Wer durch einen österreichischen Wald geht, sieht sie – hoffentlich – ganz häufig: Flechten mit ihren grauen Krusten, gelbgrünen Belägen, zarten Bartflechten. Sie fallen kaum auf und leisten doch Erstaunliches. Denn: Sie zählen zu den zuverlässigsten natürlichen Bioindikatoren für Luftqualität. Dort, wo viele verschiedene Arten wachsen, ist die Luft in der Regel sauber und wenig belastet.
Was sind Flechten?
Flechten sind Lebensgemeinschaften aus einem Pilz und einer Alge. Der Pilz bietet Schutz, Struktur und Wasserspeicherung; die Alge produziert durch Photosynthese Nahrung. Dieses Miteinander macht Flechten extrem widerstandsfähig. Sie wachsen auf Baumrinden, Felsen, Totholz, Böden und sogar auf Felswänden, Geröllflächen und Steinblöcken.
Warum gelten Flechten als wichtige Bioindikatoren?
Flechten nehmen Schadstoffe wie Schwefeldioxid, Stickoxide oder Feinstaub direkt über ihre Oberfläche auf und reagieren deshalb empfindlich auf Luftverschmutzung. Fehlen empfindliche Arten oder dominieren robuste Flechten-Arten, deutet dies auf Luftbelastungen hin.
In Österreich zeigen Langzeitstudien:
- In Zeiten hoher Luftverschmutzung (1970er/80er-Jahre) verschwanden viele Arten lokal fast vollständig.
- Mit besserer Luftqualität kehrten sie langsam zurück.
- Stickstoffeinträge aus Verkehr und Landwirtschaft bleiben jedoch ein großes Problem und verändern die Artenzusammensetzung messbar.
Quellen: Umweltbundesamt Österreich (Luftschadstoffe & Flechtenmonitoring)
Wie viele Flechtenarten gibt es in Österreich?
Es gibt eine gute Nachricht: Österreich zählt zu den flechtenreichsten Ländern Europas:
- Rund 2.300–2.400 Arten und Unterarten sind wissenschaftlich dokumentiert.
- Besonders reich an Arten sind alte Laubwälder, Bergwälder, Buchenwälder und standorttreue Einzelbäume.
Quellen: MykoKeys-Studie, Der Standard
Ökologische Funktionen von Flechten im Wald
Flechten sind zentrale Bausteine des Waldökosystems.
Sie dienen als Lebensraum.
Viele Insekten, Spinnen, Milben und Schnecken leben ausschließlich zwischen oder in Flechten. Einige Käferarten sind sogar auf bestimmte Flechten spezialisiert.
Sie liefern Nahrung.
Wildtiere wie Rehe, Hirsche oder Schneehühner fressen bestimmte Flechtenarten im Winter.
Flechten sorgen für zusätzliche organische Substanz im Wald.
Tiere nutzen sie als Nistmaterial.
Amseln, Meisen oder Kleiber bauen ihre Nester mit Bart- und Blattflechten.
Sie wirken als sogenannte Pionierarten.
Auf Fels oder Sturzkahlflächen sind sie wertvoll für Böden:
- Sie zersetzen Gestein mit organischen Säuren.
- Sie sammeln Staub und Feuchtigkeit.
- Sie bereiten den Boden für Moose, Gräser und später Bäume.
- Ohne Flechten würde die Wiederbesiedelung kahler Standorte deutlich länger dauern.
Quelle: Bundesforste, Nationalpark Kalkalpen, ResearchGate
Wie stark sind Flechten in Österreich gefährdet?
Viele Flechtenarten in Österreich gelten als gefährdet.
Hauptursachen:
1. Verlust alter Bäume
Flechten brauchen:
- strukturreiche, rissige Borken,
- alte Eichen und Buchen,
- abgestorbene Äste,
- stehendes und liegendes Totholz.
Eine moderne und nachhaltige Waldbewirtschaftung reduziert diese Strukturen häufig.
2. Stickstoffbelastung
Zu viel Stickstoff aus Verkehr und Industrie führt zu einer „Überdüngung“. Die Folgen:
- Robuste Arten nehmen überhand.
- Empfindliche Arten verschwinden.
- Die Artenvielfalt sinkt.
3. Klimawandel
Arten, die kühle und feuchte Standorte brauchen, werden nach oben gedrängt. Die Lebensräume werden enger. Irgendwann ist das Ausweichen in höhere Lagen nicht mehr möglich.
Was kann man in der Forstwirtschaft für den Schutz von Flechten tun?
- Alte Bäume erhalten.
- Stehendes und liegendes Totholz im Bestand belassen.
- Mischwälder statt Reinbestände fördern, wo es möglich ist.
- Lichte, strukturreiche Waldbilder schaffen.
- Förderung naturnaher Waldwirtschaft.
Warum sind Flechten wichtig für den österreichischen Wald?
Flechten verbessern die Luft, zeigen Umweltqualität an, fördern die Biodiversität, dienen Tieren als Nahrung und Lebensraum und sind ein unverzichtbarer Teil eines gesunden, klimafitten Waldes.
Die meisten Menschen schenken Flechten kaum Beachtung. Doch beim nächsten Waldspaziergang kann man sich darüber bewusst sein: Sie zeigen uns Luftqualität an, fördern die Artenvielfalt, stabilisieren ökologische Kreisläufe und spielen eine entscheidende Rolle bei der Wiederbesiedlung von Lebensräumen.
Ihr Schutz bedeutet den Schutz des gesamten Waldes – von der Luft, die wir atmen, bis hin zur biologischen Vielfalt, die Österreichs Wälder prägt.
Waldgeschichten auf Facebook folgen
Waldgeschichten auf Instagram folgen
Waldgeschichten auf LinkedIn folgen
Waldgeschichten auf YouTube sehen