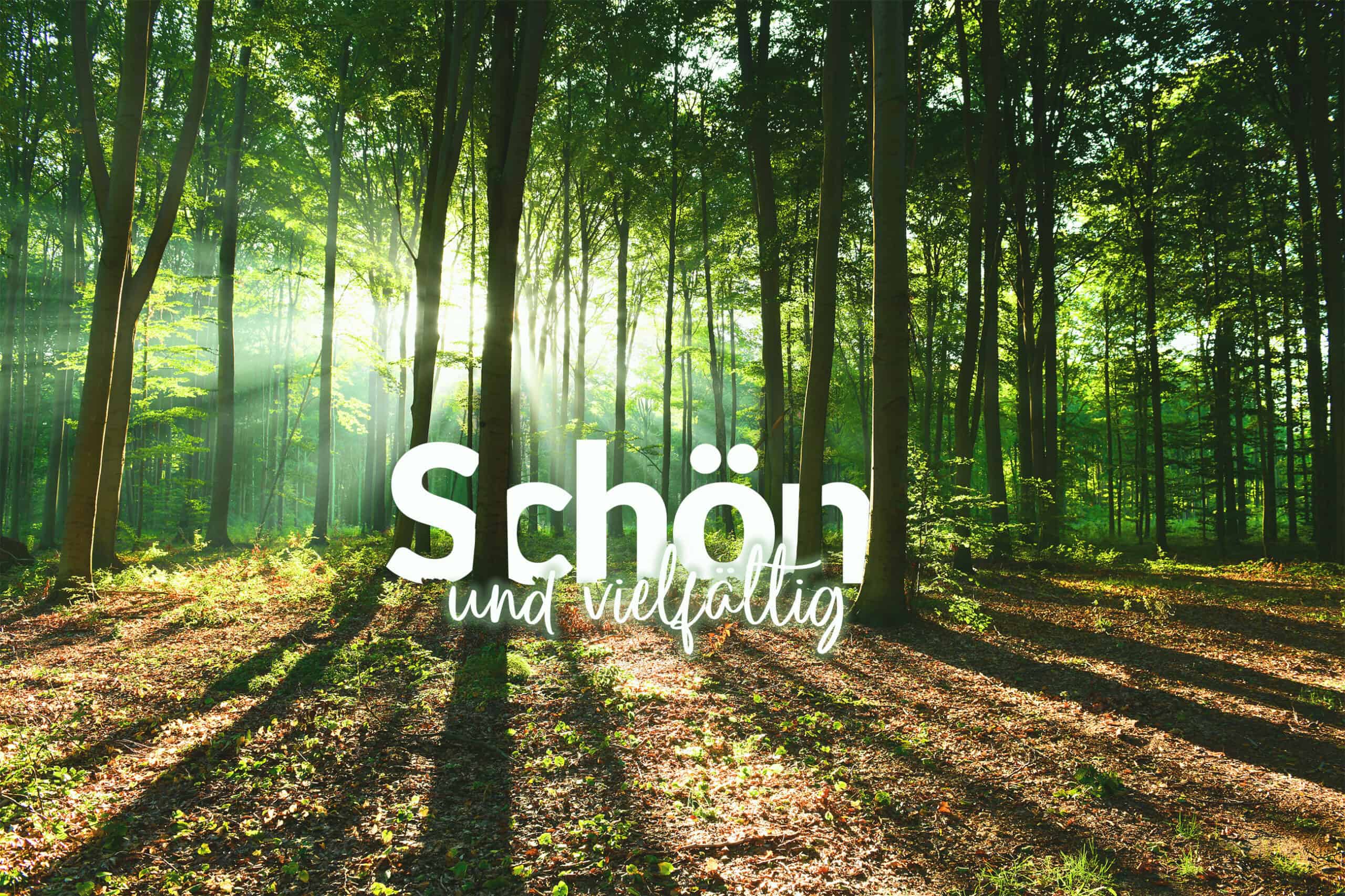© 2025 Adobe Stock, Petair
Leitfaden für nachhaltige Bauweisen
Mit einem Waldanteil von rund 47 % bietet Österreich ideale Voraussetzungen für nachhaltiges Bauen mit Holz. Heimisches Holz, am besten aus PEFC-zertifizierter Forstwirtschaft, speichert langfristig CO₂ und leistet damit einen aktiven Beitrag zum Klimaschutz. Ein Kubikmeter verbautes Holz bindet etwa eine Tonne CO₂ – und ersetzt zugleich energieintensive Baustoffe wie Beton oder Stahl.
Wohngesundheit und Raumklima
Holzkonstruktionen regulieren auf natürliche Weise Luftfeuchtigkeit und Temperatur. Ihre diffusionsoffene Bauweise sorgt für ein angenehmes, ausgeglichenes Raumklima – ganz ohne Schadstoffausdünstungen. Diffusionsoffen heißt: Feuchtigkeit kann durch die Wände entweichen, ohne dass sich Schimmel bildet. Ein Plus für Gesundheit und Wohnkomfort im modernen Holzbau in Österreich.
Wirtschaftlichkeit über Lebenszyklus
Zwar liegen die Anfangsinvestitionen oft höher, doch Holzbauten amortisieren sich durch geringere Heizkosten, eine hohe Lebensdauer und kürzere Bauzeiten. Zusätzlich fördern zahlreiche Programme in Österreich nachhaltiges Bauen – wirtschaftlich und zukunftssicher.
Kurze Bauzeiten und Planungssicherheit
Der hohe Vorfertigungsgrad im österreichischen Holzbau ermöglicht eine präzise, wetterunabhängige Montage. Dies verkürzt die Bauzeit im Vergleich zu konventionellen Bauweisen erheblich
Circular Economy im Holzbau
Holzbauten wirken wie ein zweiter Wald: Sie speichern CO₂, schonen Ressourcen und ermöglichen eine echte Kreislaufwirtschaft. Die Holz-Circular-Economy nutzt Materialien effizient, vermeidet Abfälle und verbindet Ressourcenschonung mit aktivem Klimaschutz. Wer mit Holz nachhaltig baut, senkt seinen Rohstoffverbrauch und reduziert CO₂-Emissionen. Dies ist ein wichtiger Schritt in Richtung klimafreundliche Zukunft.
© 2025 Adobe Stock, Christian Delbert
Die wichtigsten Holzbauweisen in Österreich
Der Klassiker: Holzrahmenbau
Funktionsweise
Ein tragendes Gerüst aus senkrechten Holzstützen und waagerechten Balken bildet das Grundgerüst. Die Zwischenräume werden mit Dämmmaterial gefüllt und beidseitig mit Platten verkleidet.
Anwendungsspektrum
- Einfamilienhäuser (1-2 Geschosse)
- Mehrfamilienhaus (3-6 Geschosse)
- Schnelle Bauzeit gewünscht
- Budget-optimierte Lösung
Technische Details nach österreichischen Standards
- Rahmenabstände: 62,5 cm oder 83,3 cm (abgestimmt auf Plattenmaße)
- Holzquerschnitte: 60×120 mm bis 60×240 mm je nach statischen Anforderungen
- Dämmschicht-Dicken: 140-280 mm für österreichische Klimazone
- Dampfbremse nach OIB-Richtlinie 3 (Österreichisches Institut für Bautechnik OIB)
Vorteile
- Kurze Bauzeit und flexible Planung: Der hohe Vorfertigungsgrad und das geringe Gewicht ermöglichen eine schnelle Montage – ideal für zeitkritische Projekte.
- Hervorragende Dämmwerte bei schlanken Wandaufbauten: Dank der Kombination aus tragender Struktur und Dämmmaterial lassen sich mit vergleichsweise schlanken Wandquerschnitten sehr gute U-Werte erzielen – besonders relevant für das österreichische Klima.
- Kosteneffizienz bei hoher Energieeffizienz: Der Holzrahmenbau bietet ein ausgezeichnetes Preis-Leistungs-Verhältnis – insbesondere bei Einfamilienhäusern und mehrgeschossigem Wohnbau mit begrenztem Budget.
- Einfache Installationen und spätere Änderungen: Die Hohlräume im Wandaufbau erleichtern das Verlegen und Nachrüsten von Leitungen, ohne tragende Bauteile zu beeinträchtigen.
- Hohe Ressourcen-Effizienz: Im Vergleich zum Massivholzbau ist der Materialeinsatz geringer – das spart nicht nur Kosten, sondern auch graue Energie.
Herausforderungen
- Feuchteschutz muss exakt geplant und ausgeführt werden: Der mehrschichtige Aufbau erfordert eine lückenlose Dampfbremse und sorgfältige Ausführung aller Übergänge, insbesondere nach OIB-Richtlinie 3 für luftdichte Gebäudehüllen.
- Schallschutz nur durch Zusatzmaßnahmen erreichbar: Leichte Wandkonstruktionen bieten von Natur aus geringeren Schallschutz. Dieser muss baulich (z. B. durch Vorsatzschalen, Entkopplung) verbessert werden.
- Begrenzte Masse für sommerlichen Hitzeschutz: Anders als massive Bauteile speichern Holzrahmenwände wenig Wärme. Ohne entsprechende Maßnahmen (z. B. außenliegender Sonnenschutz) kann das zu Überhitzung im Sommer führen.
- Witterungsschutz während der Bauphase notwendig: Holzrahmen-Konstruktionen sind anfällig für Feuchte-Eintrag während der Montage. Ein wettergeschützter Bauablauf oder rasche Gebäudehülle sind unerlässlich.
Die Innovation: Massivholzbau (CLT Cross Laminated Timber/ dt. Brettsperrholz)
Funktionsweise
Kreuzweise verleimte Massivholzplatten (mindestens 3 Lagen) aus österreichischer Produktion bilden tragende Wand-, Decken- oder Dachelemente.
Anwendungsspektrum
- Einfamilienhaus: Sichtholz-Oberflächen
- Mehrgeschossige Bauten (bis 8 Etagen)
- Hochhausbau: Hybrid-Bauweise mit Stahlbeton-Kern, wie beim HoHo Wien (84m, zweithöchstes Holzhochhaus weltweit)
- Sichtholz-Oberflächen gewünscht
- Höchste Stabilität erforderlich
Technische Details nach österreichischen Standards
- Planung nach ÖNORM B 1995 (Eurocode 5).
- Berücksichtigung der Schneelast in Bergregionen.
- CNC-Fertigung in österreichischen Werken (Computerized Numerical Control = computergestützte Bearbeitung von Steuerungsprozessen).
Vorteile
- Hohe Tragfähigkeit und Formstabilität: Durch die kreuzweise Verleimung der Lamellen sind CLT-Elemente besonders formstabil und belastbar – ideal für tragende Wände, Decken und Dächer.
- Kurze Bauzeiten durch Vorfertigung: CNC-gefertigte Elemente aus österreichischer Produktion ermöglichen eine millimetergenaue, schnelle und wetterunabhängige Montage vor Ort.
- Großes Anwendungsspektrum: Vom Einfamilienhaus mit sichtbaren Holzoberflächen bis zum urbanen Hochbau (z. B. HoHo Wien, 84 m) – CLT ist vielseitig einsetzbar, auch in hybriden Konstruktionen mit Beton oder Stahl.
- Angenehmes Raumklima und Wohngesundheit: CLT-Wände regulieren Temperatur und Luftfeuchtigkeit auf natürliche Weise und tragen so zu einem gesunden Wohnklima bei – ganz ohne zusätzliche Lüftungstechnik.
- Nachhaltig & CO₂-speichernd: Holz aus zertifizierter Forstwirtschaft speichert dauerhaft CO₂ und ersetzt emissionsintensive Baustoffe wie Beton oder Stahl – ein Plus für die Klimabilanz.
- Planungssicherheit und Standardisierung: Die Produktion erfolgt nach anerkannten Normen (ÖNORM B 1995 / Eurocode 5) – inklusive statischer Nachweise für Wind- und Schneelasten, auch in alpinen Lagen.
Herausforderungen
- Feuchteschutz & Bauphysik: Obwohl CLT diffusionsoffen ist, erfordert es durchdachte Detailplanung bei Feuchteeintrag, Abdichtungen und Anschlussdetails – insbesondere bei Flachdächern oder Nassräumen.
- Brand- und Schallschutz: CLT bietet trotz seiner Dicke nicht automatisch optimalen Schallschutz – dieser muss durch zusätzliche Maßnahmen (z. B. Vorsatzschalen) ergänzt werden. Auch der Brandschutz muss bei mehrgeschossigen Bauten individuell nachgewiesen werden.
- Materialkosten & Marktschwankungen: CLT ist teurer als konventionelles Bauholz. Preissteigerungen durch Rohstoffengpässe können die Kalkulation belasten.
- Logistik und Transport großer Elemente: Die großformatigen CLT-Elemente stellen hohe Anforderungen an Transportlogistik und Hebetechnik – vor allem bei innerstädtischen Baustellen.
- Komplexe Planung: Die Vorfertigung erfordert eine sehr präzise, digitale Planungsphase (BIM/CAD). Änderungen während der Bauphase sind aufwendig und dementsprechend teuer.
© 2025 Adobe Stock, helivideo
© 2025 Adobe Stock, Tomasz Zajda
Der Flexible: Holzskelettbau
Funktionsweise
Tragendes Gerüst aus österreichischen BSH-Stützen (Brettschichtholz) und -trägern übernimmt die gesamte Lastabtragung. Wände sind nur raumabschließend.
Anwendungsspektrum
- Offene Wohn- und Büroräume (bis 40 m Spannweite)
- Landwirtschaftliche Bauten (traditionell stark in Österreich)
- Gewerbe- und Industriebau
Technische Details nach österreichischen Standards
- Stützenquerschnitte: 160×160 mm bis 400×400 mm (BSH GL24h-GL32h)
- Rastermaße: 3,0-8,0 m, optimal 4,5-6,0 m
- Holzarten: BSH aus Fichte/Tanne, zunehmend Laubholz (Buche aus österreichischen Wäldern)
Vorteile
- Maximale Gestaltungsfreiheit im Grundriss: Da die Last ausschließlich über das Stützen-Träger-Gerüst abgeführt wird, sind Innenwände nicht tragend und können flexibel platziert, verändert oder sogar weggelassen werden – ideal für offene Wohn-, Büro- oder Hallenkonzepte.
- Große Spannweiten möglich: Dank Brettschichtholz (BSH) lassen sich Stützweiten von bis zu 40 m realisieren – ohne Zwischenwände oder zusätzliche Stützen. Besonders attraktiv für Hallen, Gewerbe- und Industriebauten.
- Materialeffizienz durch reduzierten Flächenverbrauch: Im Vergleich zu Massivbauweisen ist der Anteil an tragenden Bauteilen geringer – das spart Fläche und bietet mehr nutzbaren Raum.
- Hochwertige Optik durch sichtbare Konstruktion: Die tragende Struktur aus BSH kann sichtbar bleiben und bietet architektonisch ansprechende Lösungen – sowohl im modernen Wohnbau als auch im Gewerbebereich.
- Nachhaltige Materialien aus heimischer Produktion: BSH aus österreichischer Fichte, Tanne oder zunehmend Buche stammt aus zertifizierter Forstwirtschaft und bietet eine ökologische Alternative zu Stahl oder Beton.
- Hoher Vorfertigungsgrad: Präzise Rastermaße und industrielle Fertigung in österreichischen Werken (z. B. Binderholz, Hasslacher, Rubner) sorgen für kurze Bauzeiten und planbare Montage.
Herausforderungen
- Aufwendiger Brandschutz im mehrgeschossigen Bau: Freistehende Stützen- und Trägerkonstruktionen müssen im Brandfall ausreichend lange standsicher bleiben – das erfordert komplexe Nachweise und ggf. bauliche Schutzmaßnahmen.
- Wärme- und Schalldämmung muss separat gelöst werden: Da die Wände nicht tragend sind, liegt die gesamte Dämmleistung in den raumabschließenden Hüllflächen – hier ist sorgfältige Planung gefragt, insbesondere bei Fassaden- und Deckenanschlüssen.
- Aufwendigere Aussteifung notwendig: Ohne tragende Wände braucht das Gebäude zusätzliche Maßnahmen zur Aussteifung gegen Wind- und Horizontallasten – z. B. durch Diagonalverbände, Scheibenwirkung oder Betonkern.
- Statisch optimierte Rastermaße erforderlich: Der Entwurf muss frühzeitig mit dem Tragwerksplaner abgestimmt werden – falsche Rasterungen können die Materialeffizienz und Wirtschaftlichkeit stark beeinträchtigen.
- Begrenzte Standardisierung im Wohnbau: Im Vergleich zu CLT oder Holzrahmenbau ist der Holzskelettbau weniger verbreitet im klassischen Wohnbau – Planung und Ausführung erfordern mehr Erfahrung und spezialisierte Partner.
Die neue Baukultur: Holzhybridbau
Funktionsweise
Holzhybridbau kombiniert intelligente Weise verschiedene Baustoffe: Holz (meist als CLT-Elemente oder Brettschichtholz) übernimmt primär die raumbildenden und tragenden Funktionen, während Beton oder Stahl gezielt für statisch besonders beanspruchte Bereiche eingesetzt werden.
In der Praxis werden CLT-Elemente (CLT = Cross Laminated Timber, Brettsperrholz) aus österreichischer Produktion als tragende Wand-, Decken- oder Dachelemente verwendet – sichtbar oder verkleidet, je nach Architekturkonzept. Stahlbeton übernimmt in der Hybridkonstruktion tragende Funktionen in Kernbereichen wie Treppenhäusern oder Aufzugsschächten.
Anwendungsspektrum
- Einfamilienhaus: mit sichtbaren Holzoberflächen und wohngesundem Raumklima.
- Mehrgeschossige Bauten: bis zu 8 Etagen, auch in urbanem Umfeld.
- Hochhausbau: Hybridlösungen mit Betonkern, z. B. beim HoHo Wien (84 m, dritthöchstes Holzhochhaus weltweit).
Interessant: Das höchste Massivholzgebäude der Welt (Stand 08/25) ist das Ascent MKE in Milwaukee, USA. 25 Stockwerke erstrecken sich auf eine Höhe von rund 87 Metern. Sowohl das Holz als auch die fertigen Bauteile stammen aus Österreich – von Wiehag (Oberösterreich) und KLH (Kärnten).
Ideal bei:
- sichtbaren Holzoberflächen,
- hoher statischer Belastung,
- hohen Anforderungen an Nachhaltigkeit und Geschwindigkeit.
Technische Details nach österreichischen Standards
- Planung: nach ÖNORM B 1995 (Eurocode 5)
- Standsicherheit: inklusive Nachweise für Schneelastzonen in alpinen Regionen
- Fertigung: mit CNC-Technologie in österreichischen CLT-Werken
- Integration: Hybridbauweise mit Stahlbeton oder Stahlträgern nach Bedarf
- Brandschutz und Statik: gemäß nationalen und europäischen Normen – kombinierbar mit ÖNORM B 1992 (Beton)
Vorteile
- Hohe Tragfähigkeit und Formstabilität: CLT-Elemente zeichnen sich durch ihre massive Struktur und die kreuzweise Verleimung aus. Das ermöglicht hohe Lastabtragung bei gleichzeitig geringem Eigengewicht – ideal für tragende Strukturen.
- Kurze Bauzeiten durch Vorfertigung: Die industriell vorgefertigten Elemente ermöglichen einen präzisen, schnellen und weitgehend wetterunabhängigen Aufbau auf der Baustelle – ein großer Vorteil bei engen Zeitplänen.
- Großes Anwendungsspektrum: Vom kompakten Einfamilienhaus mit Naturcharme bis zum urbanen Hochhaus – CLT ist vielseitig einsetzbar. Besonders in Hybridkonstruktionen mit Beton oder Stahl bietet das Material neue Freiheiten.
- Angenehmes Raumklima und Wohngesundheit: CLT reguliert Temperatur und Luftfeuchtigkeit auf natürliche Weise. Die Holzoberflächen wirken positiv auf das Wohlbefinden – ganz ohne aufwändige Lüftungstechnik.
- Nachhaltig und CO₂-speichernd: CLT wird aus heimischem Nadelholz hergestellt, stammt meist aus zertifizierter Forstwirtschaft und speichert während der gesamten Lebensdauer CO₂ – ein aktiver Beitrag zum Klimaschutz.
- Planungssicherheit und Normung: Die Fertigung erfolgt streng normgerecht. Österreichische Standards wie die ÖNORM B 1995 garantieren statische Sicherheit – auch für extreme Schnee- oder Windlasten in alpinen Lagen.
Herausforderungen
- Feuchteschutz und Bauphysik: CLT ist diffusionsoffen, aber nicht immun gegen Feuchtigkeit. Bei Flachdächern, Nassräumen und Anschlüssen ist eine detaillierte Planung nötig, um Schäden zu vermeiden.
- Brand- und Schallschutz: Trotz seiner Masse bietet CLT nicht automatisch den geforderten Schallschutz. Zusätzliche Maßnahmen wie Vorsatzschalen oder schwimmende Estriche sind erforderlich. Auch der Brandschutz muss je nach Gebäudehöhe individuell nachgewiesen werden.
- Materialkosten und Marktschwankungen: CLT ist teurer als konventionelles Bauholz. Steigende Rohstoffpreise und knappe Verfügbarkeiten können die Kalkulation belasten, gerade bei großen Projekten.
- Logistik und Transport: Die großformatigen Elemente (bis zu 3 x 16 m) erfordern durchdachte Logistik und Spezialtransporte. vor allem bei engen innerstädtischen Baustellen kann dies eine Herausforderung sein.
- Hohe Anforderungen an Planung und Koordination: Die hohe Vorfertigungstiefe erfordert eine exakte digitale Planung (CAD/BIM). Änderungen während der Bauphase sind schwierig und verursachen oft Mehrkosten.
© 2025 Adobe Stock, Alexandre Zveiger
© 2025 Adobe Stock, Jarama
Der Schnelle und Flexible: Holzmodulbau
Der Holzmodulbau steht für eine neue Generation des Bauens: schnell, ressourcenschonend, hochqualitativ. Durch vollständig vorgefertigte Raummodule aus Holz werden Gebäude nicht mehr Stein für Stein errichtet, sondern präzise wie industrielle Produkte gefertigt – in Werkshallen österreichischer Spezialbetriebe.
Funktionsweise
Beim Holzmodulbau entstehen komplett vorgefertigte Raummodule in trockenen Werkshallen. Jedes Modul umfasst bereits:
- Tragstruktur (z. B. Holzrahmenbau),
- Dämmung,
- Fenster, Böden, Haustechnik,
- teils sogar Küche, Bad und Möblierung.
Die fertig ausgebauten Module werden anschließend per LKW auf die Baustelle transportiert, dort mit dem Kran versetzt und zu einem funktionalen Gebäude verbunden. Und das oft in nur wenigen Tagen.
Anwendungsspektrum
- Studentenwohnheime: z. B. in der Seestadt Aspern, Wien
- Soziales Wohnen: SMART-Wohnungen in Wien (28–35 m²)
- Hotels: Vienna House Easy by Wyndham, Wiener Airport City, Fertigstellung voraussichtlich Ende 2025
- Bürobauten: Temporäre oder dauerhafte Arbeitsräume
- Bildungseinrichtungen: Schnelle Kapazitätslösungen für Kindergärten und Schulen
Technische Details nach österreichischen Standards
- Modulgrößen: Max. 4,0 × 16,0 × 3,2 m (Transportgrenze für LKW)
- Standardraster: 3,0 m, 3,6 m oder 4,2 m Breite
- Wandaufbau: Holzrahmen 160–200 mm + Dämmung 140–180 mm
- Deckenaufbau: Holzbalkendecke oder CLT (140–200 mm)
- Vorfertigungsgrad: Bis zu 95 % (inkl. Elektrik, Sanitär, Bodenbeläge)
Die Produktion erfolgt unter streng kontrollierten Bedingungen nach österreichischen Qualitätsnormen und mit hoher Wiederholgenauigkeit.
Vorteile
- Extrem kurze Bauzeit durch hohen Vorfertigungsgrad: Bis zu 95 % der Bauleistungen werden wetterunabhängig in der Werkhalle erbracht. Dadurch reduziert sich die Bauzeit auf der Baustelle um bis zu 80 %. Der Innenausbau kann unmittelbar nach der Montage beginnen.
- Hohe Ausführungsqualität durch industrielle Fertigung: Die Produktion unter kontrollierten Werkbedingungen ermöglicht millimetergenaue Ausführung, gleichbleibende Qualität und geringe Mängelraten – unabhängig von Wetter, Baustellenlogistik oder Fachkräftemangel vor Ort.
- Flexibilität im Lebenszyklus – rückbaubar und versetzbar: Modulgebäude lassen sich demontieren, erweitern oder an einen anderen Standort versetzen. Dies ist ein Vorteil für temporäre Nutzungen, Nachverdichtung oder zirkuläres Bauen.
- Geringe Baustellenemissionen: Da die meisten Arbeiten im Werk erfolgen, reduzieren sich Lärm, Staub und Bauabfälle vor Ort deutlich. Dies zeigt sich als besonders vorteilhaft in sensiblen, urbanen oder lärmsensiblen Bereichen wie Schulumgebungen oder Wohn- und Pflegeheimen.
- Hohe Planungssicherheit und Kostenkontrolle: Die klar definierten Produktionsprozesse und Vorlaufzeiten ermöglichen exakte Terminplanung und belastbare Kalkulation. Sie sind also ideal für Projekte mit engem Zeit- und Budgetrahmen.
Herausforderungen
- Modularer Entwurf erfordert frühzeitige Abstimmung: Das gesamte Gebäude muss von Beginn an modular gedacht werden. Rastermaße, Raumgrößen und Gebäudetechnik müssen exakt auf Transport, Fertigung und Montage abgestimmt sein. Nachträgliche Änderungen sind aufwendig und kostenintensiv.
- Transportmaße begrenzen architektonische Freiheit: Die Modulgröße ist durch LKW-Transport auf max. 4 × 16 Meter begrenzt. Das beeinflusst Raumabmessungen, Fassadengestaltung und Fensterpositionierung und erfordert kreative Planungsansätze.
- Komplexe Gebäudetechnik-Verteilung zwischen Modulen: Installationen wie Strom, Wasser, Lüftung oder Smart-Home-Systeme müssen exakt zwischen den Modulen koordiniert werden. Fehler in der Planung führen zu erheblichem Mehraufwand bei der Montage
- Kranlogistik und Baustellenzugang müssen vorbereitet sein: Für die Montage sind freie Kranstellflächen und Just-In-Time-Lieferungen notwendig. In engen städtischen Lagen oder beengten Grundstücken kann dies zum logistischen Engpass werden.
- Begrenzte Gestaltungsspielräume bei Individualprojekten: Die hohe Standardisierung bringt Vorteile für Kosten und Geschwindigkeit, schränkt jedoch die gestalterische Freiheit bei Einzelprojekten ein, vor allem im privaten Wohnbau oder bei Architekturprojekten mit Sonderwünschen.
Der Gipfel des modernen Holzbaus: Ingenieur-Holzbau
Der Ingenieur-Holzbau markiert die Spitze des modernen Holzbaus. Genau dort, wo außergewöhnliche Tragweiten, komplexe Formen und innovative Verbindungstechniken gefragt sind. Ob Sporthalle, Brücke oder ikonisches Dachtragwerk: Hier verschmelzen Materialkompetenz, Hightech-Fertigung und präzise Ingenieurskunst.
Funktionsweise
Im Ingenieur-Holzbau werden tragende Holzelemente wie Brettschichtholz (BSH), Furnierschichtholz (LVL) oder Brettstapelholz (DLT) für anspruchsvolle Tragwerke eingesetzt, oft in Kombination mit Stahl oder Faserverbund-Werkstoffen.
Die Konstruktionen entstehen projektindividuell und werden mithilfe parametrischer Planung, 3D-Statik (FEM) und CNC-Fertigung präzise vorgefertigt. Das Ziel: das Realisieren besonders großer Spannweiten, gekrümmter Geometrien oder freier Formen – häufig ohne Zwischenstützen.
Anwendungsspektrum
- Sporthallen und Stadien: Spannweiten von 40 bis über 100 m
- Infrastrukturprojekte: z. B. Brücken, Bahnsteigüberdachungen
- Kulturbauten & Landmark-Architektur: Freiformdächer, Holzgitter
- Industrie- und Messehallen: Große Flächen, kurze Bauzeiten
- Bildungsbauten: Kombiniert mit Sichtbarkeit und Nachhaltigkeit
Technische Details nach österreichischen Standards
- Planung & Bemessung: nach ÖNORM B 1995 (Eurocode 5), ergänzt um individuelle statische Nachweise
- Materialeinsatz: BSH, LVL, DLT, GFK- oder CFK-verstärkte Bauteile
- Fertigung: CNC-gesteuert, häufig 5- oder 6-Achs-Bearbeitung
- Nachweise: Schwingung, Brand, Knotenstatik – oft projektspezifisch
- Forschung & Prüfung: z. B. durch Holzforschung Austria, BOKU Wien
Vorteile
- Außergewöhnliche Spannweiten ohne Zwischenstützen: Mit Hochleistungs-Holzwerkstoffen wie LVL und BSH lassen sich Tragwerke über 100 Meter realisieren, Damit ist die Bauweise ideal für Hallen, Brücken und Dächer mit freier Fläche.
- Freie Formgebung für ikonische Architektur: Durch CNC-Fertigung, 3D-Statik und digitale Planung sind gekrümmte, geschwungene oder freigeformte Tragwerke möglich – mit hohem ästhetischen Anspruch.
- Hochfeste Werkstoffe bei geringem Eigengewicht: Furnierstreifenholz (LVL) weist deutlich höhere Festigkeiten auf als BSH. Perfekt für schlanke Querschnitte und reduzierten Materialeinsatz bei maximaler Tragfähigkeit.
- Innovative Verbindungstechniken: 3D-gedruckte oder gefräste Stahlknoten, Carbonfaser-Verstärkungen oder fugenlose Klebungen ermöglichen hoch belastbare und elegante Anschlüsse.
- Planungssicherheit durch digitale Prozesse: Die Kombination aus BIM, FEM und parametrischer Modellierung ermöglicht exakte Vorab-Simulation und verhindert Planungsfehler in der Ausführung.
- Klimafreundlich und ressourcenschonend: Trotz technischer Komplexität bleibt Holz klimaneutral, speichert CO₂ und ersetzt energieintensive Baustoffe. Gerade bei großen Gebäuden ist dies ein starker Hebel für die Klimabilanz.
Herausforderungen
- Hoher Planungsaufwand und Spezialwissen erforderlich: Freiformen und große Spannweiten verlangen eine interdisziplinäre Planung. Architekten, Statiker und Fertigungsbetriebe müssen idealerweise bereits in der Vorentwurfsphase eng zusammenarbeiten.
- Kostenintensive Sonderverbindungen: Stahlknoten, geklebte Verbindungen und Sonderanschlüsse können hohe Einzelkosten verursachen, gerade bei Unikaten oder Sonderformen.
- Aufwendige Montage mit Spezialgerät: Die Montage großer Bauteile erfordert Spezialkräne, erfahrene Monteure und exakte Logistikplanung. Vor allem bei innerstädtischen Baustellen ist dies zu berücksichtigen.
- Schwingungs- und Bauphysiknachweise notwendig: Große Spannweiten bringen dynamische Anforderungen mit sich. Insbesondere bei Sport- oder Veranstaltungsbauten sind diese individuellen Nachweise zur Schwingung unerlässlich.
- Erhöhte Planungskosten und Gesamtaufwand: Ingenieur-Holzbau erfordert rund 8 bis 15 % Planungsanteil an den Baukosten (im Vergleich zu 3 bis 5 % bei Standardbauten). Diese Investition zahlt sich jedoch durch Bauqualität und Innovation aus.
© 2025 Adobe Stock, AP
Holzwerkstoffe aus österreichischer Produktion
Konstruktionsvollholz (KVH)
“Das Standardholz”: Technisch getrocknetes KVH aus österreichischer Fichte/Tanne. Holzfeuchte max. 15 %, sortiert nach ÖNORM DIN 4074.
Brettschichtholz (BSH)
“Für große Spannweiten”: Aus festigkeitssortierten Lamellen verleimte Träger. Österreichische Besonderheit: Auch aus Laubholz (Buche) für höhere Festigkeiten.
CLT/Brettsperrholz
“Die Holzwand aus einem Stück”: Österreich ist Weltmarktführer bei CLT-Produktion mit Herstellern wie KLH, Stora Enso und Binderholz.
© 2025 Adobe Stock, SockaGPhoto
© 2025 Adobe Stock, PascalR
Qualitäten und Standards
- Rohstoffqualität und Herkunft: Österreichische Forstwirtschaft: 4 Mio. Hektar Wald (47 % der Landesfläche)
- Nachhaltigkeit: Laut Österreichischer Waldinventur liegt der Holzzuwachs über der jährlichen Nutzung, obwohl wenn das Wachstumstempo derzeit zurückgeht (Stand 08/25). Selbst bei steigender Nachfrage wird damit nicht mehr geerntet, als nachwächst – ein zentrales Prinzip der österreichischen Forstwirtschaft.
- Zertifizierung: PEFC Austria oder FSC Austria garantiert nachhaltige Bewirtschaftung
- Prüfung: Nach ÖNORM-Standards
- Holzarten: 85 % Nadelholz (Fichte, Tanne, Kiefer), 15 % Laubholz
Wichtige österreichische Institutionen
- proHolz Austria: Interessensvertretung der Holzwirtschaft
- Holzbau Austria: Bundesverband der Holzbauunternehmen
- Holzforschung Austria: Prüfung und Zertifizierung
- Österreichisches Institut für Bautechnik (OIB): Technische Regelwerke
Neu ab 2026: Staatspreis Holzbau für Österreich
Erstmals wird 2026 der Österreichische Staatspreis Holzbau vergeben, initiiert vom Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft in Zusammenarbeit mit proHolz Austria. Der Preis würdigt herausragende Leistungen im modernen Holzbau und macht die Innovationskraft heimischer Betriebe sichtbar – von der Architektur über die Planung bis zur handwerklichen Ausführung. Nominiert sind alle Projekte, die in den Jahren 2023 bis 2025 bereits mit einem Landes-Holzbaupreis ausgezeichnet wurden.
Praktische Entscheidungshilfen
Förderungen in Österreich
Bundesförderung: Sanierungsscheck, Raus aus Öl und Gas
Die Förderinitiative zur Sanierung (“Sanierungsbonus”) und zum Energieumstieg („Raus aus Öl und Gas“) wurde im Rahmen der Sanierungsoffensive 2023/24 umgesetzt. Dabei konnten Anträge bis maximal 50 % der förderfähigen Investitionskosten betragen, z. B. Wärmepumpen, Pellet- oder Holzheizungen <100 kW. Allerdings sind die Fördertöpfe seit Ende 2024 ausgeschöpft und aktuell ist keine neue Antragstellung möglich. Hier gibt’s weitere Informationen.
Länderförderungen (unterschiedlich je Bundesland)
Förderungen variieren je Bundesland – vom Wohnbauförderungslandesdarlehen bis zu Zuschüssen für ökologische Baustoffe. Beispielsweise bietet Niederösterreich Zuschläge für ökologisches Bauen, Oberösterreich vergibt zinsgünstige Landesdarlehen mit Förderbonus. Mehr dazu hier.
EU-Förderungen: LEADER-Programme für ländliche Gebiete
Das LEADER-Programm unterstützt Projekte in ländlichen Regionen, auch zum Thema Holzbau. Seit Juli 2023 läuft die Förderperiode 2023–2027. Lokale Aktionsgruppen (LAGs) vergeben regional Förderungen etwa für nachhaltige Bauinitiativen – ideal auch für gemeindliche Holzbauprojekte.
© 2025 Adobe Stock, DesignArts
5 häufige Mythen über den Holzbau – und was wirklich stimmt
Holzbau in Österreich wird immer beliebter – doch viele hartnäckige Vorurteile halten sich bis heute. Hier räumen wir mit den häufigsten Holzbau-Mythen auf – fachlich fundiert und nach österreichischem Baurecht geprüft.
Mythos 1: Holz brennt leichter als andere Baustoffe
Die Wahrheit: Holz brennt zwar – aber kontrolliert und berechenbar. Besonders Brettsperrholz (CLT) bildet bei Feuer eine schützende Verkohlungsschicht, die das Innere des Bauteils stabil hält. Moderne Holzbauten erreichen Feuerwiderstandsklassen von REI 90* bis REI 120 laut OIB-Richtlinie 2 und Eurocode 5 – also mindestens 90 Minuten Tragfähigkeit, Raumabschluss und Wärmedämmung im Brandfall.
Die Bezeichnung REI stammt aus dem europäischen Brandschutzstandard und setzt sich wie folgt zusammen:
R (Resistance) = Tragfähigkeit: Das Bauteil bleibt stabil und trägt weiterhin Last.
E (Integrity) = Raumabschluss: Flammen und heiße Gase dringen nicht durch das Bauteil.
I (Insulation) = Wärmedämmung im Brandfall: Die temperaturbedingte Erwärmung auf der vom Feuer abgewandten Seite bleibt so gering, dass benachbarte Räume geschützt werden – keine Brandübertragung durch Hitzeleitung.
Mythos 2: Holzbau ist immer teurer als Massivbau
Die Wahrheit: Die reinen Baukosten eines Holzhauses können höher erscheinen. Doch im Lebenszyklus-Vergleich sind Holzbauten oft günstiger – wegen kürzerer Bauzeit, geringerer Heizkosten dank hervorragender Dämmwerte und weniger Wartungsaufwand. Vor allem bei energieeffizientem Bauen in Österreich punktet Holz mit hoher Wirtschaftlichkeit.
Mythos 3: Holz ist ungeeignet für feuchte Klimazonen
Die Wahrheit: Richtig geplant und ausgeführt, ist Holz sehr widerstandsfähig gegen Feuchtigkeit. Konstruktiver Holzschutz, diffusionsoffene Wandaufbauten, Dachüberstände und spritzwassergeschützte Fassaden sorgen für langlebige Bauteile – auch bei Regen und Schnee. In Österreich gelten dafür klare Standards wie ÖNORM B 3802 und die OIB-Richtlinie 3 (Luftdichtheit & Feuchteschutz).
Der moderne Holzbau erfüllt höchste Anforderungen an Sicherheit, Energieeffizienz und Nachhaltigkeit. In Kombination mit nachhaltiger Waldbewirtschaftung und kurzen Transportwegen bietet er ein enormes Potenzial für klimafreundliches Bauen in Österreich. Wer mit Holz baut, baut für die Zukunft und räumt ganz nebenbei mit alten Vorurteilen auf.
Mythos 4: Holz ist schlecht für den Schallschutz
Die Wahrheit: Mehrschichtige Elementaufbauten, entkoppelte Bauteile und masseträge Systeme: Moderne Holzbauten können heute höchste Schallschutzklassen erfüllen. Speziell im Mehrfamilienhausbau werden Wand- und Deckensysteme so aufgebaut, dass nicht nur Trittschall, sondern auch Luftschall modernen Anforderungen entspricht. Dies geschieht mithilfe einer Kombination aus Holzmasse und Dämmlagen.
Auch bei erhöhten Normanforderungen (z. B. in Schulbauten oder Wohnanlagen) ist der Schallschutz kein Hindernis. Passende Holzbausysteme erreichen problemlos erforderliche Klassen.
Mythos 5: Ein Holzbau altert schneller als ein Haus aus Ziegeln oder Beton
Die Wahrheit: Ein Holzhaus altert nicht schneller als ein Ziegel- oder Betonbau, solange das Holz trocken bleibt. Zusätzlich lassen sich einzelne Bauteile im Holzbau leichter sanieren oder austauschen. Das macht ihn sogar besonders zukunftssicher.
© 2025 Adobe Stock, Olha
© 2025 Adobe Stock, mckornik
Rechtliche Rahmenbedingungen
Bauordnungen der Bundesländer
Österreich hat neun verschiedene Bauordnungen (eine pro Bundesland). Seit 2008 basieren die technischen Vorschriften auf den harmonisierten OIB-Richtlinien 1-6, die in allen Bundesländern verbindlich sind.
Wichtige Unterschiede zwischen den Bundesländern (Beispiele)
- Wien: Holzbau bis 6 Geschosse möglich (seit 2015)
- Niederösterreich: Unterschiedliche Regelungen je nach Baugebiet
- Steiermark: Als waldreichstes Bundesland besonders holzbaufreundlich
- Tirol/Salzburg: Berggebiets-spezifische Anforderungen
Normen und Zertifizierungen
- ÖNORM B 1995 (Eurocode 5): Bemessung von Holztragwerken
- OIB-Richtlinie 2: Brandschutz im Holzbau
- OIB-Richtlinie 3: Hygiene, Gesundheit und Umweltschutz
- PEFC Austria/FSC Austria: Nachhaltige Waldbewirtschaftung
Geprüft und präzisiert: Entwicklungen im österreichischen Holzbau
Laubholz im Holzbau: Laubholz, insbesondere Buche, wird zunehmend im tragenden Holzbau eingesetzt – besonders dort, wo höhere Festigkeit gefordert ist (z. B. in mehrgeschossigen Bauten). Österreich ist europaweit führend in der Entwicklung von Laubholz-CLT.
Digitaler Holzbau: Österreichische Vorreiter wie Binderholz, Rubner oder Wiehag setzen längst auf digitale Planung und CNC-gesteuerte Produktion – insbesondere bei komplexen Holzkonstruktionen.
Digitale Planungsmethoden
- BIM (Building Information Modeling): Bei mittleren und großen Projekten ist BIM inzwischen Standard in der Planung und Koordination – vor allem bei öffentlich ausgeschriebenen Bauten.
- CAD/CAM-Integration: Der digitale Planungsprozess wird direkt in die CNC-Fertigung überführt. Österreichische Hersteller verfügen über moderne industrielle Vorfertigung.
- Digitaler Zwilling: Digitale Zwillinge (Planung + Simulation) kommen vermehrt bei Forschungsprojekten und komplexen Großbauten zum Einsatz, etwa zur Simulation von Energiebedarf oder sommerlichem Hitzeschutz. Spezielle Klimasimulationen für österreichische Bedingungen sind technisch möglich, aber kein flächendeckender Standard.
Innovative österreichische Holzwerkstoffe
- KLH-Platten: KLH (Marke von KLH Massivholz GmbH) aus der Steiermark gilt als Pionier des CLT seit den 1990er-Jahren – mittlerweile weltweit im Einsatz.
- Duo/Trio-Balken: Mehrschichtig verklebte Balken bieten höhere Formstabilität und werden unter anderem von österreichischen Herstellern wie Hasslacher produziert.
Österreichische Leuchtturmprojekte
HoHo Wien: 84 m hoch, 24 Geschosse, Hybridbauweise mit 75 % Holzanteil. Entwickelt von Kerbler Gruppe und RLP Architekten und international bekannt.
Lifecycle Tower ONE in Dornbirn, Vorarlberg: Ein achtgeschossiger Holz-Hybrid-Prototyp von “Cree by Rhomberg”; mit serieller Bauweise, energieeffizientem Konzept und BIM (Building Information Modeling).
Neue Holzbaupreise: In fast allen Bundesländern werden regelmäßig Holzbaupreise vergeben – z. B. von proHolz OÖ, der Holzbaupreis Steiermark, Holzbaupreis Tirol etc. Ab 2026 werden sie erstmals in den Staatspreis Holzbau auf Bundesebene eingebunden.
© 2025 DerFritz
U. J. Alexander
Häufige Fragen zum Holzbau in Österreich
Ist Holzbau wirklich brandsicher?
Ein moderner Holzbau ist nicht mehr brandgefährdet als andere Bauten. CLT erreicht Brandwiderstand REI 90-120 nach OIB-Richtlinie 2. Das HoHo Wien (84 Meter hoch) ist tatsächlich ein erfolgreiches Beispiel für Holzhochbau mit besonderen Brandschutzlösungen. Allerdings sind die Brandschutz-Anforderungen für Holzbau komplex und abhängig von der Gebäudeklasse. Brennbare Baustoffe sind bei Feuerwiderstandsdauern bis 60 Minuten grundsätzlich möglich, bei 90 Minuten nur unter bestimmten Bedingungen.
Wie lange hält ein Holzhaus?
Ein gut geplantes, fachgerecht gebautes und regelmäßig gewartetes Holzhaus kann heute mehrere Generationenüberdauern. Entscheidend ist nicht das Material allein, sondern Konstruktion, Standort und Pflege. Hier sind die wichtigsten Punkte:
- 80–120 Jahre: realistisch für ein Einfamilienhaus in moderner Holzbauweise (Holzrahmenbau, Holzskelettbau, Brettsperrholz/CLT).
- 150–200 Jahre: erreichbar bei sehr hochwertiger Ausführung, konstruktivem Holzschutz und regelmäßiger Wartung.
- Historische Beispiele zeigen: Alpenhäuser oder Fachwerkhäuser stehen oft seit 200–400 Jahren.
Warum sind (moderne) Holzhäuser so langlebig?
Moderne Holzhäuser verbinden traditionelles Handwerkswissen mit innovativer Bauweise. Ihre Langlebigkeit beruht auf vier zentralen Faktoren:
- Konstruktiver Holzschutz: Durch Dachüberstände, Spritzwasserschutz und eine gute Entwässerung bleibt das Holz dauerhaft trocken.
- Materialauswahl: Es wird überwiegend heimisches Nadelholz verwendet; bei stärkerer Beanspruchung kommen Lärche oder Douglasie zum Einsatz. Tragende Teile sind in der Regel technisch getrocknet.
- Diffusionsoffene Bauweise: Die Wände regulieren Feuchtigkeit und beugen Schimmelbildung vor.
- Regelmäßige Wartung: Fassaden aus Holz, Putz oder Farbe sollten alle 10–20 Jahre überprüft und bei Bedarf instandgesetzt werden.
Welche Holzarten werden generell beim Holzbau in Österreich verwendet?
Beim Holzbau in Österreich dominiert heimisches Nadelholz. Rund 80 % der heimischen Wälder bestehen aus Nadelbäumen, wobei die Fichte die unangefochtene Nummer eins ist. Sie ist leicht, gut verfügbar und im Vergleich zu anderen Hölzern preiswert. Fichtenholz wird vielfältig eingesetzt – von Wohnhäusern und Dachstühlen bis hin zu Brücken, Fußböden und tragenden Konstruktionen.
Tanne und Kiefer werden ähnlich wie Fichte genutzt. Tannenholz eignet sich für Konstruktionsvollholz, Fenster, Türen und Treppen, während Kiefernholz vor allem im Innenausbau und bei sichtbaren Elementen verwendet wird.
Für den Außenbereich ist die Lärche besonders gefragt. Ihr Holz ist natürlich widerstandsfähig und kommt traditionell als Wetterschutz zum Einsatz – etwa bei Fassaden, Außenverkleidungen und Terrassen. Lärchenholz vergraut im Laufe der Zeit gleichmäßig, was es optisch ansprechend und pflegeleicht macht.
Bei tragenden Konstruktionen mit hoher statischer Belastung wird Brettschichtholz (BSH) eingesetzt. Es besteht aus mehreren verleimten Lamellen und wird meist aus Fichte, Tanne oder Kiefer hergestellt; für witterungsbeanspruchte Bereiche kommen auch Lärche oder Douglasie zum Einsatz.
Für welche Bauweise wird in Österreich welches Holz verwendet?
In Österreich wird Holzbau überwiegend mit heimischem Nadelholz umgesetzt. Fichte ist das am häufigsten eingesetzte Bauholz, weil es leicht, gut verfügbar und kostengünstig ist. Tanne und Kiefer ergänzen vor allem im Rahmenbau und Dachbereich. Für hochbelastete Bauteile und innovative Holzhochhäuser kommt zunehmend Buchenholz zum Einsatz. Bei witterungsbeanspruchten Konstruktionen wie Hallen oder Fassaden werden auch Lärche und Douglasie verwendet.
Holzrahmenbau (Einfamilienhäuser)
- Bevorzugte Holzarten: Fichte, Tanne.
- Einsatz: Tragende Ständer, Riegel, Dachkonstruktionen.
- Vorteile: Günstig, leicht, sehr gut verfügbar.
Massivholzbau / CLT (Mehrfamilienhäuser und Sichtflächen)
- Bevorzugte Holzarten: Fichte (Standard), Buche (für hohe Tragfähigkeit).
- Einsatz: Wände, Decken, großformatige Platten.
- Vorteile: Hohe Stabilität, Sichtqualität, kurze Bauzeit.
Holzskelettbau (Gewerbebauten und Hallen)
- Bevorzugte Holzarten: Brettschichtholz (BSH) aus Fichte, optional Lärche oder Douglasie.
- Einsatz: Stützen, Träger, weit gespannte Binder.
- Vorteile: Große Spannweiten, flexible Grundrisse, hohe Formstabilität.
Holzhybridbau (Bürogebäude, Schulen, mehrgeschossiger Wohnbau)
- Bevorzugte Holzarten: Fichte (für tragende Holzbauteile), Buche (Punktlasten), kombiniert mit Beton und Stahl.
- Einsatz: Decken, Wände, Stützen (Holz), Treppenhäuser, Kerne (Beton).
- Vorteile: Materialgerecht kombiniert, wirtschaftlich, feuer- und schallschutztechnisch optimierbar, hohe Planungssicherheit.
Holzmodulbau (Kindergärten, Schulen, Hotels, Wohnanlagen)
- Bevorzugte Holzarten: Fichte (für Wände, Decken), teilweise Buche (für hochbelastete Elemente).
- Einsatz: Vorgefertigte Raumzellen mit fertiger Innenausstattung, Tragwerk, Hülle und Technik.
- Vorteile: Extrem kurze Bauzeit durch hohen Vorfertigungsgrad, hohe Präzision, geringes Baustellenrisiko, sofort nutzbar.
Ingenieur-Holzbau (Brücken, Türme, Sonderbauten)
- Bevorzugte Holzarten: Brettschichtholz (Fichte, Lärche, Douglasie), zunehmend Buche oder Esche für hohe Lasten.
- Einsatz: Tragwerke mit hoher statischer Anforderung, Sonderformen, Freiformkonstruktionen.
- Vorteile: Hohe Tragfähigkeit, komplexe Geometrien möglich, langlebig bei richtiger Ausführung, sichtbar und repräsentativ.
Wichtige Anlaufstellen für den Holzbau in Österreich
Wer in Österreich mit Holz bauen möchte – ob privat, gewerblich oder kommunal – findet ein starkes Netzwerk an Beratungsstellen, Fachbetrieben und Ausbildungseinrichtungen. Diese Partner stehen für Qualität, Innovation und Nachhaltigkeit im Holzbau.
Institutionen und Fachstellen
proHolz Austria
→ Österreichweite Informationsplattform für Holzbau, Architektur, Forstwirtschaft und Bildung. Beratung zu Bauweisen, Förderungen und Materialien.
Holzbau Austria
→ Netzwerk qualifizierter Holzbaubetriebe mit Fokus auf Fachausbildung, Zertifizierung (z. B. Holzbau-Meister) und technische Standards.
Ländliche Entwicklung (LE14–20/LEADER)
→ Förderberatung für nachhaltige Holzbauprojekte in ländlichen Regionen – organisiert über Bundesländer und Lokale Aktionsgruppen.
Landwirtschaftskammern der Bundesländer
→ Ansprechpartner für land- und forstwirtschaftliche Bauprojekte mit Holz – inklusive Förderung und Technikberatung.
Ausbildung & Qualifikation im Holzbau
HTL Holztechnik
→ Technische Mittelschulen mit Schwerpunkt Holzbau, Bauplanung und Konstruktion – u. a. in Kuchl (Salzburg), Hallein, Mödling, Krems oder Pinkafeld.
Fachhochschulen & Universitäten
→ Studiengänge zu Holztechnologie, Holzbau, Nachhaltiges Bauen und Holzindustrie – z. B. an der FH Salzburg, FH Kärnten, FH Campus Wien oder der BOKU Wien.
Meisterprüfungen
→ Zimmerer- und Tischlermeister nach österreichischem Berufsrecht – Qualifikationen mit hohem Praxisanteil und europaweiter Anerkennung.
Erfahre hier mehr zum Thema “Wald und Beruf(ung) – im und mit dem Wald arbeiten”
© 2025 Adobe Stock, Watercolor_Art_Photo
© 2025 Countrypixel
Österreich – weltführend im modernen Holzbau
Insgesamt zählt Österreich international zu den führenden Nationen im Holzbau – mit einer besonders starken Stellung im Bereich des maschinell gefertigten Massivholzbaus (CLT, Brettschichtholz, Hybridkonstruktionen). Unternehmen wie KLH Massivholz GmbH (Marktführer für großformatige CLT‑Elemente mit globaler Exportreichweite) oder Binderholz GmbH (rund 5.000 Beschäftigte, Präsenz in 28 Ländern) zeigen eindrucksvoll die Innovationskraft und internationale Wettbewerbsfähigkeit der Branche.
Auch Holzbaufirmen wie Wiehag beliefern weltweite Großprojekte – u. a. wurden die tragenden Bauteile für den aktuell höchsten Holz-Wolkenkratzer („Ascent“ in Milwaukee) aus Österreich exportiert. Aufgrund fehlender technischer Expertise und Ressourcen im jeweiligen Zielland wurde hier österreichisches Know-how eingekauft.
Initiativen wie Advantage Austria fördern gezielt die internationale Ausstrahlung heimischer Holzbautechnologie: Auf Fachveranstaltungen in Skandinavien oder China präsentieren österreichische Unternehmen ihre CLT‑Lösungen und nachhaltigen Baukonzepte.
Damit kombiniert Österreich das Beste aus allem: reiche Waldressourcen, modernste Fertigungstechnologien und internationale Vertriebskompetenz.
Glossar
- BIM – Building Information Modeling: Digitaler Prozess zur Planung, Verwaltung und Nutzung eines Bauwerks über seinen Lebenszyklus.
- BSH – Brettschichtholz: Mehrschichtig verleimtes Holz für tragende Konstruktionen.
- CAD – Computer-Aided Design: Software für technische Zeichnungen und 3D-Modelle.
- CFK – Kohlenstofffaserverstärkter Kunststoff: Leichter, sehr fester Verbundwerkstoff.
- CLT – Cross Laminated Timber (Brettsperrholz): Mehrschichtig kreuzweise verleimte Massivholzplatten.
- DLT – Brettstapelholz: Mechanisch verbundene Holzlagen für tragende Bauteile.
- FEM – Finite-Elemente-Methode: Numerisches Verfahren zur Berechnung von Konstruktionen und Materialverhalten.
- GFK – Glasfaserverstärkter Kunststoff: Stabiler, leichter Verbundwerkstoff aus Kunststoff und Glasfasern.
- KVH – Konstruktionsvollholz: Technisch getrocknetes, maßhaltiges Bauholz.
- LVL – Laminated Veneer Lumber (Furnierschichtholz): Aus Holzfurnieren verleimtes, hochfestes Konstruktionsholz.
- OIB – Österreichisches Institut für Bautechnik: Einrichtung zur Harmonisierung von Bauvorschriften in Österreich.
- ÖNORM – Von Austrian Standards herausgegebener Standard für Sicherheit, Qualität und Innovation in Österreich.
- PEFC Austria – Programme for the Endorsement of Forest Certification: Zertifizierungssystem für nachhaltige Waldbewirtschaftung.
- REI – Resistance – Integrity – Insulation: Feuerwiderstandsklassifizierung von Bauteilen.
© 2025 Adobe Stock, SockaGPhoto
Zum Weiterlesen
Zum Nachlesen
Rechte & Produktion
© 2024 Die österreichischen Familienwaldbetriebe & Österreichischer Forstverein – Unterstützt durch den Holzinformationsfonds der Landwirtschaftskammer Österreich
Redaktion
Wir haben sorgfältig recherchiert und Informationen zusammengetragen. Wenn ihnen dennoch etwas auffällt, was sie ändern würden oder etwas zu ergänzen wäre, bitten wir sie, Kontakt mit uns aufzunehmen. Wir freuen uns über ihre Rückmeldung und Anregungen.