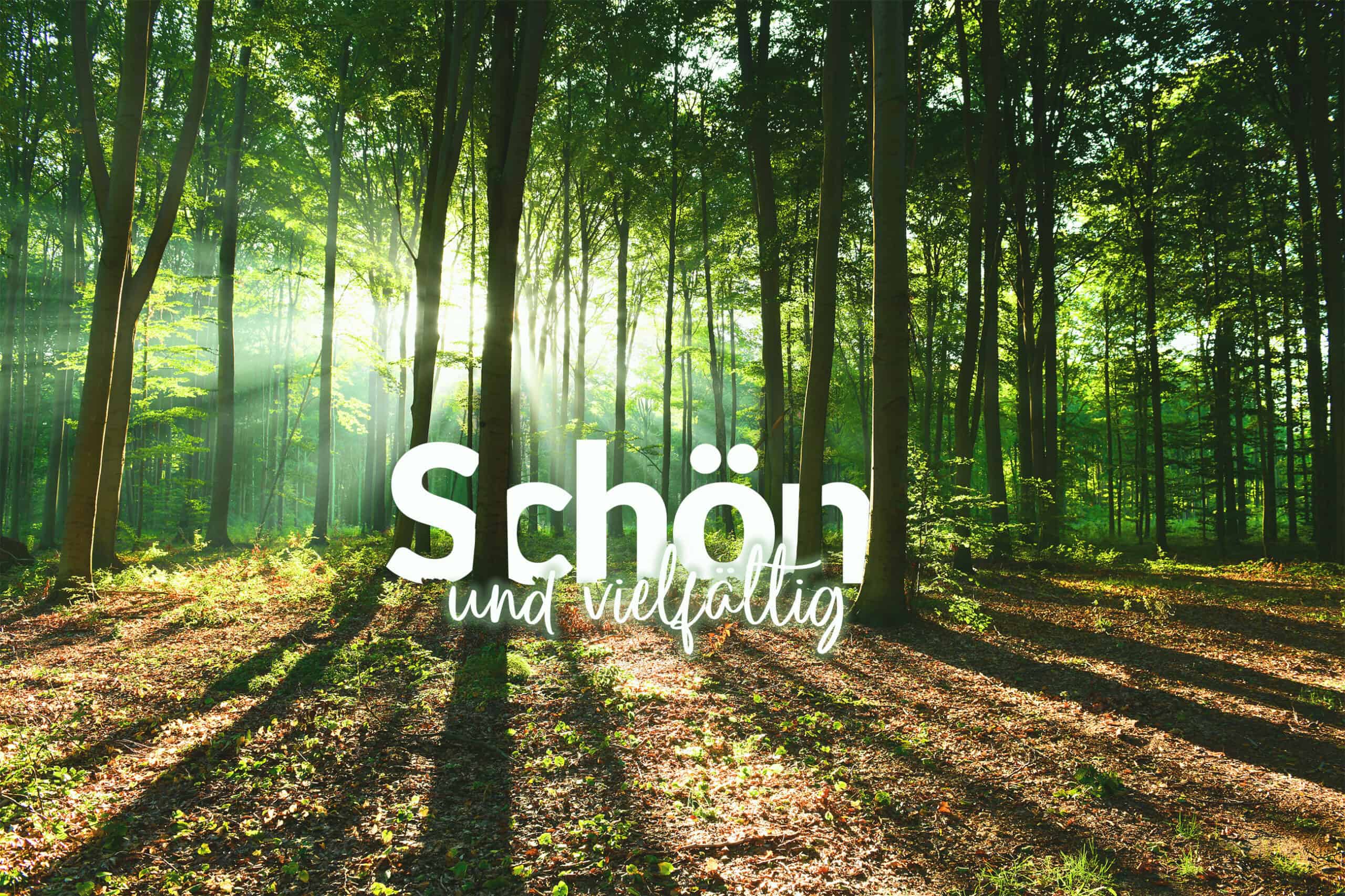Während im Herbst in Wien die Pilzfestspiele das Reich der Mykologie feiern, spielt sich in Österreichs Wäldern täglich ein stilles Schauspiel ab: Pilze verbinden, zersetzen und erneuern – sie sind die unsichtbaren Netzwerker des Lebens.
Obwohl sie in den Wäldern allgegenwärtig sind, wird ihre Bedeutung für die Biodiversität und Bodenfruchtbarkeit oft unterschätzt. Denn Pilze sind weit mehr als herbstliche Sammelobjekte: Sie sind Motoren des Nährstoffkreislaufs im Wald; sie schaffen Lebensräume für unzählige Insektenarten und sorgen dafür, dass Totholz wieder zu Erde wird.
Ein eindrucksvolles Beispiel dafür ist der Eichen-Wirrling (Daedalea quercina) – ein Pilz, der auf den ersten Blick unscheinbar wirkt, für den Lebenskreislauf des Waldes jedoch unverzichtbar ist.
Beispiel Eichen-Wirrling: Mikrokosmos und Motor des Waldlebens
Wer an Biodiversität denkt, hat meist Vögel, Wildblumen oder seltene Insekten im Kopf – aber kaum Pilze. Dabei sind sie die stillen Architekten des Waldes. Einer von ihnen ist der Eichen-Wirrling (Daedalea quercina) – ein Pilz, der auf den ersten Blick unscheinbar wirkt, für den Lebenskreislauf des Waldes jedoch sehr wichtig ist.
Spezialist für den Biokreislauf
Der Eichen-Wirrling ist ein typischer Bewohner von Eichen- bzw. Eichen-/Buchenwäldern. Er wächst vor allem in alten oder abgestorbenen Eichenstämmen und zersetzt dort das innere, harte Kernholz.
Er frisst sich sozusagen durch das Holz und wandelt die festen Bestandteile in eine bröselige, hellbraune Masse. Die Folge: Das Holz wird spröde und rissig – für die Eiche selbst ist das keine Hilfe. Aber für den Wald ist dieser Pilz wichtig: Er sorgt dafür, dass abgestorbene Stämme langsam zerfallen und sich wieder in Erde verwandeln. So kommen die Nährstoffe zurück in den Boden – und genau das hält den Kreislauf im Wald am Laufen.
Totholz als Lebensraum
Totholz gilt als einer der wichtigsten Indikatoren für Biodiversität im Wald. Wenn der Eichenwirrling Eichenholz zersetzt, entstehen neue Mikro-Lebensräume: Spalten, Hohlräume und nährstoffreiche Bereiche, die anderen Organismen Lebensraum bieten.
Eine Studie in Schweden dokumentierte, dass in den Fruchtkörpern des Eichenwirrlings mehr als 40 Insektenarten leben oder ihre Larven entwickeln.
So hilft der Pilz, neue ökologische Nischen zu schaffen. Wo er arbeitet, entstehen Bedingungen, unter denen Moose, Flechten, Mikroorganismen und Insekten siedeln – ein kleiner Mikrokosmos, der wiederum Teil des großen Waldökosystems wird.
Ein Beitrag zur Waldgesundheit
Der Eichenwirrling befällt also kein vitales, gesundes Holz, sondern besiedelt geschwächte Bäume und bereits abgestorbene Äste. Damit erfüllt er eine zentrale ökologische Funktion: Er hilft, Alt- und Totholz abzubauen, wodurch Nährstoffe wieder in den Boden gelangen – der Kreislauf des Waldes bleibt geschlossen.
Zwischen Nutzen und Risiko
Für die Wald-Biodiversität ist der Pilz ein Gewinn, für die Statik alter Bäume oder Holzkonstruktionen kann er jedoch zur Gefahr werden. Die durch ihn verursachte Braunfäule führt zu Holzversprödung – bei starkem Befall steigt die Astbruchgefahr.
In der Forstpraxis gilt der Eichen-Wirrling daher als „biologisch nützlich, technisch bedenklich“ – ein gutes Beispiel dafür, wie natürliche Prozesse und menschliche Nutzung im Wald oft in Spannung stehen und ein gutes Beispiel dafür, wie viel Fingerspitzengefühl unsere Forstleute brauchen, um beides in Balance zu halten.
Der Eichen-Wirrling ist ein Meister der Zersetzung – und genau das macht ihn so wichtig. Er steht für den unsichtbaren Kreislauf im Wald, in dem jedes Ende zugleich ein Anfang ist.
Ohne Pilze wie ihn gäbe es keine Humusschichten, keine neuen Keimorte, keine Balance zwischen Leben und Vergehen.
Was auf den ersten Blick wie Verfall aussieht, ist in Wahrheit der Motor des Lebens – unsichtbar, geduldig und von zentraler Bedeutung für die Biodiversität in unseren österreichischen Wäldern.
Waldgeschichten auf Facebook folgen
Waldgeschichten auf Instagram folgen
Waldgeschichten auf LinkedIn folgen
Waldgeschichten auf YouTube sehen