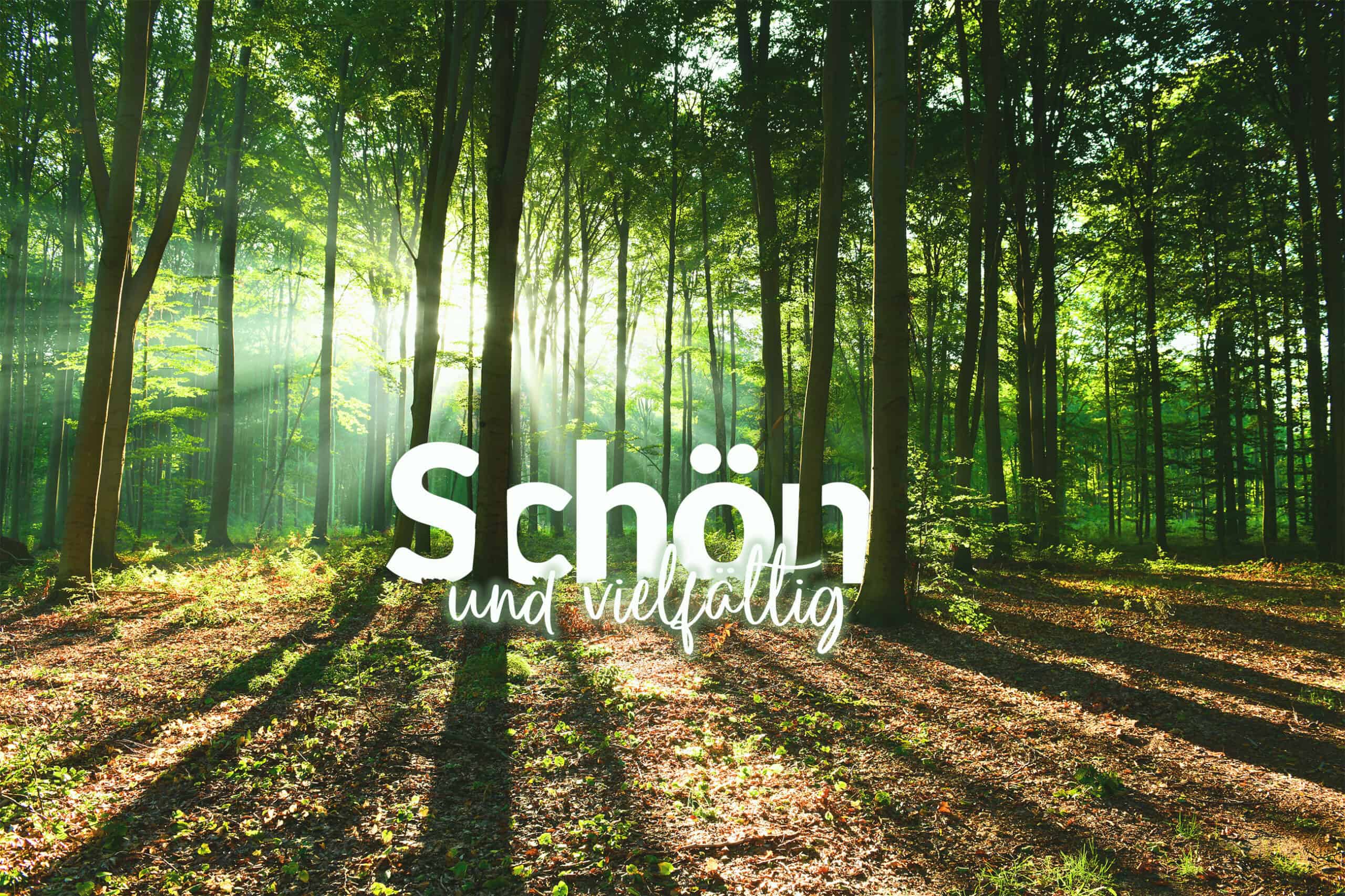© 2025 Adobe Stock, Alexandra Giese
Wer hat dieses große Schauspiel noch nicht beobachtet – und war fasziniert von den riesigen Vogelschwärmen im Herbst. Wenn sie z.B. über Neusiedlersee, Donau-Auen, Zeller See oder über Alpenpässe und -täler in Richtung Süden ziehen.
Der Vogelzug ist eines der faszinierendsten Naturphänomene. Millionen Vögel verlassen im Herbst ihre Brutgebiete und kehren im Frühjahr zurück. Österreich spielt dabei eine Schlüsselrolle – als Brutplatz, Raststation und Überwinterungsgebiet. Jede Art hat ihre eigene Strategie; jede erzählt vom Zusammenspiel zwischen Wald, Klima und Biodiversität.
© 2025 Adobe Stock, Antje Lindert-Rottke
Definition: Was sind Zugvögel?
Zugvögel sind Tiere, die im Herbst ihre Brutgebiete verlassen und in mildere Regionen ziehen. Der Grund: eine reine Überlebensstrategie, um mehr Nahrung und bessere Überlebensbedingungen zu finden.
Im Frühjahr kehren sie zurück, um zu Brüten und in den langen, hellen Tagen ihre Jungen großzuziehen. Auch in Österreich sind sie gut zu beobachten: am Neusiedler See, in den Donauauen, an Zeller Seen oder in Alpentälern. Österreichs Wälder sind dabei nicht nur Brutgebiete, sondern auch wichtige Raststationen für Zugvögel aus Nord- und Osteuropa auf ihrem Weg nach Süden.
Warum gibt es den Vogelzug?
Der Auslöser: Wenn die Tage kürzer werden, meldet sich bei den Vögeln sozusagen ihre innere Uhr. Photoperiodismus nennen Wissenschaftler die Fähigkeit, die Tageslänge und damit auch die Jahreszeit zu „bestimmen“. Die Vögel spüren: Die Tage werden kürzer, es wird kühler bzw. kalt – das Futter wird knapp. In den warmen Regionen Afrikas oder Südeuropas dagegen finden sie reichlich Nahrung.
Das Klima: Frost und Schnee machen es Vögeln schwer, im Winter Energie zu sparen. Der Flug in mildere Gebiete erhöht die Überlebenschancen.
Brutplätze: Im Frühsommer sind Österreichs Wälder ideale Bruträume – sicher, nahrungsreich, mit Platz für Nester und langen Tagen für die Aufzucht der Jungen. Im Winter ist es hier für viele Arten zu karg.
Evolution: Arten, die zogen, hatten stets höhere Überlebenschancen und gaben ihr Verhalten weiter. Über Generationen wurde der Vogelzug so zu einem festen Bestandteil im Jahresrhythmus.
© 2025 Adobe Stock, SYI uncensored photo
© 2025 Adobe Stock,Alexandra Giese
Fliegen Zugvögel immer in Gruppen – oder auch allein?
Manche Vögel ziehen allen, manche in kleinen Gruppen, andere in riesigen Schwärmen.
Arten, die im Schwarm ziehen: Viele Vögel fliegen in lockeren Formationen oder Schwärmen, etwa Stare, Gänse oder Kraniche. Der Vorteil: Energiesparen durch Windschatteneffekt (V-Formation) und mehr Sicherheit vor Feinden.
Arten, die einzeln oder in kleinen Trupps ziehen: Viele Singvögel – darunter typische Waldarten wie Rotkehlchen, Laubsänger oder Nachtigallen – ziehen oft allein oder in kleinen Gruppen. Darunter sind auch sogenannte Nachtzieher, d.h. sie wandern überwiegend nachts.
Diese 10 heimischen Waldvögel zählen zu den Zugvögeln
Kurzstreckenzieher (Europa → Mittelmeerraum)
Buchfink
- Zugverhalten: Teilzieher, d.h. einige bleiben – andere ziehen
- Nutzen für den Wald: Samen- und Insektenfresser, reguliert Bestände
Rotkehlchen
- Zugverhalten: Kurzstreckenzieher; teils Wintergast aus Nordeuropa
- Nutzen für den Wald: Insektenvertilger, wichtiger Teil des Nahrungsnetzes
Amsel
- Zugverhalten: Teilzieher; ein Teil zieht, andere bleiben Standvögel
- Nutzen für den Wald: Samenverbreitung, Insektenkontrolle
Grasmücke (z. B. Mönchsgrasmücke)
- Zugverhalten: Kurz- bis Langstreckenzieher; Winter im Mittelmeerraum oder Afrika
- Nutzen für den Wald: Wichtiger Insektenfresser, teils Standvogel durch Klimawandel
Langstreckenzieher (Europa → Afrika südlich der Sahara)
Trauerschnäpper
- Zugverhalten: Langstreckenzieher bis Westafrika
- Nutzen für den Wald: Insektenvertilger, Indikator für strukturreiche, naturnahe Wälder
Waldlaubsänger
- Zugverhalten: Langstreckenzieher bis Zentralafrika
- Nutzen für den Wald: Raupenvertilger, stabilisiert Insektenpopulationen
Wendehals
- Zugverhalten: Langstreckenzieher; Überwinterung in Ost- und Südafrika
- Nutzen für den Wald: Frisst Ameisen und ist damit ein wichtig für die ökologische Balance, sodass ein starkes Überwiegen einzelner Ameisenpopulationen nicht andere Insekten verdrängen kann. Er weist auf strukturreiche Wälder hin.
Pirol
- Zugverhalten: Langstreckenzieher bis Afrika südlich der Sahara
- Nutzen für den Wald: Frisst Insekten und Schädlinge, Indikator für naturnahe Wälder
Baumpieper
- Zugverhalten: Langstreckenzieher bis Afrika
- Nutzen für den Wald: Insektenvertilger
Nachtigall
- Zugverhalten: Langstreckenzieher bis in die Tropen Afrikas
- Nutzen: Insektenfresser, ihr Gesang hat hohen kulturellen Wert
Kuckuck
- Zugverhalten: Langstreckenzieher; Winter in Zentral- und Südafrika
- Nutzen: Vertilgt viele behaarte Raupen, die andere Vögel meiden
Auf dem Bild: ein Waldlaubsänger
© 2025 Adobe Stock, atiger
© 2025 Adobe Stock, Jorge
Strategien und Herausforderungen beim Vogelzug
Der Vogelzug ist nicht nur ein spektakuläres Naturschauspiel, sondern auch ein komplexes Zusammenspiel aus unterschiedlichen Strategien und Risiken. Jede Art hat eigene Lösungen gefunden, um Energie zu sparen, sich zu orientieren und Gefahren zu meistern.
- Teilzieher: Bei manchen Arten (z. B. Buchfink, Amsel) zieht nur ein Teil der Population.
- Zugstrategien: Rotkehlchen und Grasmücken wandern vor allem nachts, während Störche und Greifvögel zu den Tagziehern gehören.
- Orientierung: Vögel nutzen den Sternenhimmel, das Magnetfeld, auffällige Landmarken und sogar Infraschall.
- Gefahren: Energieverlust, Raubfeinde, Jagd im Mittelmeerraum oder in den Überwinterungsgebieten, der Verlust von Rastplätzen, Klimawandel, Lichtverschmutzung und Kollisionen bedrohen ihre Reise.
Diese Strategien und Herausforderungen zeigen, wie anpassungsfähig Zugvögel sind und wie sehr ihr Überleben von intakten Lebensräumen abhängt.
Bild: Lichtverschmutzung kann Zugvögel in Gefahr bringen – sie verlieren z.B. ihre Orientierung.
Ökologische Bedeutung der Zugvögel für den Wald
- Vögel sind Indikatoren für Klimaveränderungen (z. B. frühere Rückkehr, verschobene Routen).
- Sie helfen beim Insektenmanagement im Wald. Das heißt: Zugvögel verhindern Massenvermehrungen von potenziellen Schädlingen. Spechte z.B. fressen Borkenkäfer und ihre Larven, die unter der Baumrinde sind; Waldlaubsänger beispielsweise lieben die für die Eiche so schädlichen Eichenwickler-Raupen.
- Die Artenvielfalt wechselt saisonal: Im Sommer kommen Brutvogelarten dazu, im Winter andere Durchzügler und Gäste – alles in allem sorgt der Vogelzug für eine dynamische Vielfalt.
Bild: Spechte vertilgen u.a. Borkenkäferlarven
© 2025 Adobe Stock, cimbat4
© 2025 Adobe Stock, Holger.S
Woher wissen Vögel, wohin sie fliegen müssen?
Angeborener Instinkt: Bei vielen Zugvögeln ist die Richtung genetisch festgelegt. Auch junge Vögel, die noch nie zuvor geflogen sind, schaffen es oft allein bis ins Winterquartier.
Sterne und Sonne: Nachtzieher wie das Rotkehlchen orientieren sich am Sternenhimmel, Tagzieher unter anderem an der Position der Sonne. Dank ihrer „inneren Uhr“ behalten sie auch bei der wandernden Sonne während des Tages die korrekte Flugrichtung bei.
Magnetfeld der Erde: Viele Arten besitzen Magnetrezeptoren im Auge oder im Schnabel, mit denen sie das Erdmagnetfeld „fühlen“ können.
Landschaften und Flüsse: Erfahrene Vögel nutzen Landmarken wie Alpenpässe, Flüsse oder Küstenlinien als „Straßen am Himmel“.
Soziales Lernen: Bei manchen Arten lernen Jungvögel die Route, indem sie sich älteren Vögeln anschließen (z. B. Störche, Gänse). Bei anderen ist der Zug genetisch programmiert, sodass selbst unerfahrene Jungvögel den Weg finden. Erstaunlich sind der Kuckuck und viele kleine Singvögel: Sie finden den Weg allein und ganz instinktiv.
Geruchsinn: Manche Arten wie der Sturmvogel navigieren mit ihrem Geruchssinn.
Infraschall: Kontinente, Meere, Wasserfälle, Gebirgszüge beispielsweise haben eigene Infraschall-Signaturen, teils über viele tausend Kilometer hinweg. Diese sehr niedrigen Frequenzen sind für das menschliche Ohr normalerweise nicht wahrnehmbar – für Zugvögel schon.
Wie beeinflusst der Klimawandel den Vogelzug?
Der Klimawandel hat tiefgreifende Auswirkungen auf den Vogelzug, die sich deutlich beobachten lassen:
Früherer Frühjahrszug: Viele Zugvögel kehren mittlerweile 1 bis 3 Wochen früher aus ihren Winterquartieren zurück als noch vor 30 bis 40 Jahren. Der Grund: die milderen Temperaturen im Frühjahr, die früher einsetzen.
Verspäteter oder ausbleibender Herbstzug: Der Wegzug im Herbst verzögert sich bei vielen Arten, da die Temperaturen länger mild bleiben und Nahrung länger verfügbar ist. Manche Populationen überwintern sogar zunehmend in Mitteleuropa.
Verkürzte Zugstrecken und neue Überwinterungsgebiete: Aus Langstreckenziehern werden Kurzstreckenzieher. Mitteleuropa bietet „neue“ Überwinterungsgebiete.
Probleme durch Zeitverschiebung zwischen Vogelzug und Nahrungsangebot: Das größte Problem entsteht, wenn die Ankunftszeit der Vögel nicht mehr mit dem Höhepunkt des Nahrungsangebots übereinstimmt:
Raupen schlüpfen durch wärmere Temperaturen früher: Langstreckenzieher, die ihre Zugroute genetisch programmiert haben, kommen oft zu spät.
Die Jungenaufzucht fällt dann nicht mehr in die Zeit des maximalen Nahrungsangebots.
Veränderte Zugrouten
- Zugrouten verschieben sich nordwärts.
- Neue Rastplätze werden wichtig, während traditionelle an Bedeutung verlieren.
- Alpine Pässe werden durch schneearme Winter länger passierbar.
- Wüstenausbreitung in Afrika macht manche Routen gefährlicher (Verschiebung des Sahel-Gürtels).
Zunehmende Gefährdung durch extreme Wetterereignisse
- Stärkere Stürme während der Zugzeiten.
- Dürren in Rastgebieten.
- Starkregen und Hagel während der Brutzeit.
- Hitzewellen in Brut- und Überwinterungsgebieten.
Veränderung der Lebensräume
Wegen des Rückgangs der Fichte beispielsweise verlieren spezialisierte Arten Lebensraum. Dies gilt nicht allein für Brutvögel in Österreichs Wäldern, sondern auch für manche Zugvögel. Waldlaubsänger und Mönchsgrasmücken etwa finden weniger Brutplätze; es fehlen Schutz- und Nistmöglichkeiten ebenso Nahrungs-Insekten für die Aufzucht der Jungen. Zusätzlich betrifft es die sogenannten Strichvögel: Sie ziehen nur wenige hundert Kilometer weit, je nachdem, wo sie am meisten Nahrung finden. Zu ihnen zählen z.B. der Fichtenkreuzschnabel, das Wintergoldhähnchen und der Tannenhäher.
Bild: Kuckuck
.
© 2025 Adobe Stock, Piotr Krzeslak
© 2025 Adobe Stock, Karin Jähne
Schutzmaßnahmen für Zugvögel
Der Klimawandel stellt eine der größten Herausforderungen für Zugvögel dar. Während sich manche Arten erfolgreich anpassen, sind andere existenziell bedroht. Die Geschwindigkeit der Veränderungen überfordert oft die Anpassungsfähigkeit, besonders bei Arten mit langen Generationszeiten und komplexen Zugstrategien.
Wichtige Ansätze sind:
Trittsteinbiotope: Schaffen von Rastplätzen entlang neuer Zugrouten.
Vernetzung: Biotop-Verbund für flexible Anpassung.
Monitoring: Langzeitbeobachtung zur Früherkennung von Problemen.
Schutz der Überwinterungsgebiete: Internationale Zusammenarbeit nötig.
Reduzieren anderer Stressfaktoren: Pestizidreduktion, Lichtverschmutzung minimieren.
Bild: Trittsteinbiotope sind auch für Zugvögel wichtig
So lassen sich Zugvögel beobachten
Fernglas und Notizbuch: Schon mit einfachen Mitteln lassen sich Arten und Zugbewegungen festhalten. Besonders eindrucksvoll: Morgen- und Abendstunden im Herbst und Frühjahr.
Beobachtungsorte: Hotspots sind der Neusiedler See, Donau-Auen, March-Thaya-Gebiet oder Alpenpässe, wo Zugvögel rasten oder gebündelt ziehen.
Apps & Tools:
- BirdLife Vogel-App: Speziell für Österreich, mit Beobachtungstipps.
- EuroBirdPortal: Zeigt Zugbewegungen europaweit in Echtzeit.
Mitmachaktionen: BirdLife Österreich organisiert Vogelbeobachtungstage, Beringungsaktionen und Citizen-Science-Projekte wie die „Stunde der Wintervögel“.
Veranstaltungen: Naturführungen, Exkursionen und Birdwatching-Events finden regelmäßig in Nationalparks (z. B. Donau-Auen, Gesäuse, Neusiedler See-Seewinkel) statt.
💡 Tipp: Geduld, warme Kleidung und ein Blick durch die Baumwipfel – viele Zugvögel hört man oft, bevor man sie sieht.
.
© 2025 Adobe Stock, ristiano Gala
© 2025 Adobe Stock, Nitr
Welche Waldvögel sind keine Zugvögel – und warum?
Auch im Winter sind Österreichs Wälder nicht stumm: Viele Vögel bleiben das ganze Jahr über hier oder ziehen nur zum Teil in den Süden. So bleibt die Vogelwelt auch im Winter ein wichtiger Bestandteil der Waldbiodiversität.
Standvögel: Sie bleiben das ganze Jahr im Wald
- Meisen (Kohlmeise, Blaumeise, Tannenmeise): suchen auch im Winter nach Samen, Insektenlarven oder Futterstellen.
- Spechte (Buntspecht, Schwarzspecht): finden Nahrung im Holz, auch bei Frost.
- Eichelhäher: legt Vorräte aus Eicheln und Nüssen an.
- Dompfaff (Gimpel): frisst Knospen, Samen und Beeren.
- Rabenvögel (Rabenkrähe, Elster, Kolkrabe): Allesfresser mit großem Nahrungsspektrum.
Teilzieher – teils hier, teils unterwegs
- Amsel: Viele Amseln bleiben das ganze Jahr hier, zusätzlich kommen Wintergäste aus Nord- und Osteuropa nach Österreich.
- Buchfink: Männchen bleiben häufiger, Weibchen ziehen Richtung Mittelmeer.
- Star: Viele ziehen, manche überwintern inzwischen hier.
Bild: Kohlmeise und Blaumeise
Aktuelle Forschung und Monitoring zum Vogelzug
BirdLife Österreich
Wichtigste ornithologische NGO des Landes, Partner von BirdLife International
Koordiniert Beringungsprogramme, Monitoring des Vogelzugs und Citizen-Science-Projekte („Stunde der Wintervögel“, „Stunde der Gartenvögel“).
EuroBirdPortal zeigt Live-Karten zur Zugbewegung.
Österreichische Vogelwarte (Konrad-Lorenz-Institut für Vergleichende Verhaltensforschung, Wien)
Sitz: Wien (Universität Wien, Vetmeduni).
Betreibt Forschung zur Tierwanderung, Vogelökologie und Verhalten.
Beringung und GPS-Tracking von Zugvögeln.
Konrad-Lorenz-Institut für Vergleichende Verhaltensforschung (KLF, Seewinkel/Burgenland & Wien)
Partnerinstitution der Vetmeduni.
Forschungsschwerpunkt: Verhalten und Zugstrategien von Vögeln.
Naturhistorisches Museum Wien (NHM), Abteilung Ornithologie
Sammlung mit ca. 200.000 Vogelpräparaten.
Forschung zu Artenvielfalt, Morphologie und historischen Daten zum Vogelzug.
Universitäten mit Forschungsprojekten
- Universität Wien (Department für Botanik & Biodiversitätsforschung) – Forschung zu Ökologie & Biodiversität.
- Vetmeduni Wien – Verhalten, Migration, Tiergesundheit.
- Universität für Bodenkultur (BOKU), Wien – Fokus auf Landschaftsökologie und Biodiversität, teils Schnittstellen zu Zugvögeln.
.
© 2025 Adobe Stock, Maria
Zum Weiterlesen
Zum Nachlesen
Rechte & Produktion
© 2024 Die österreichischen Familienwaldbetriebe & Österreichischer Forstverein – Unterstützt durch den Holzinformationsfonds der Landwirtschaftskammer Österreich
Redaktion
Wir haben sorgfältig recherchiert und Informationen zusammengetragen. Wenn ihnen dennoch etwas auffällt, was sie ändern würden oder etwas zu ergänzen wäre, bitten wir sie, Kontakt mit uns aufzunehmen. Wir freuen uns über ihre Rückmeldung und Anregungen.