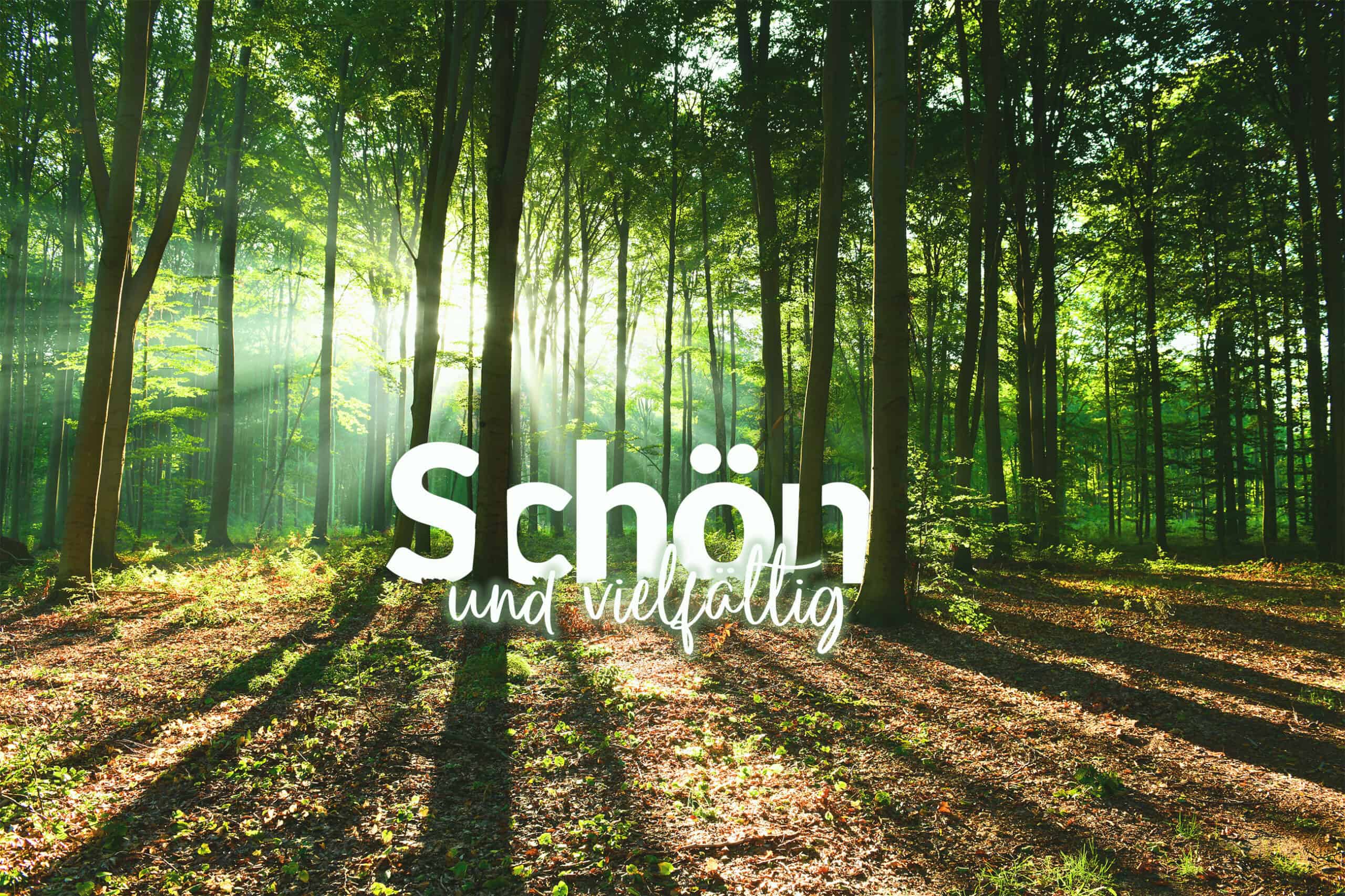© 2025 Susanna Teufl
Was ist ein Wildnisgebiet?
Wildnisgebiete sind streng geschützte Flächen, in denen die Natur sich vollständig selbst überlassen bleibt – ohne forstliche Nutzung, ohne Tourismus, ohne Eingriffe. Ziel ist es, natürliche Prozesse zu beobachten, Artenvielfalt zu erhalten und Rückzugsräume für seltene Lebensgemeinschaften zu schaffen. In Österreich ist das Wildnisgebiet Dürrenstein-Lassingtal eines der bedeutendsten Beispiele – mit dem Urwald Rothwald als Herzstück.
Im Rahmen der Österreichischen Forsttagung 2025 in St. Pölten begab sich eine Gruppe aus Forstexpert:innen auf eine Exkursion der besonderen Art: Ziel war das Wildnisgebiet Dürrenstein-Lassingtal, eine der wenigen verbliebenen Waldregionen Europas, in denen die Natur sich ungestört entfalten darf. Begleitet wurden die Teilnehmer:innen von DI Maria von Rochow und DI Katharina Pfligl. Die beiden Fachfrauen gaben Einblick in die Besonderheiten und die forstwissenschaftliche Bedeutung dieses einzigartigen Gebiets.
© 2025 Susanna Teufl
Totholz als Lebensgrundlage
Windwürfe, Lawinen, Käferkalamitäten – was andernorts als Schaden betrachtet wird, gilt im Wildnisgebiet nicht als Eingriff, sondern als natürlicher Bestandteil des Ökosystems. Der bewusste Verzicht auf forstliche Maßnahmen ist hier zentrales Prinzip. Besonders eindrucksvoll: Die konsequente Entscheidung, sämtliches Totholz – ob stehend oder liegend – in der Fläche zu belassen. Das Ergebnis ist nicht etwa Verfall, sondern Vielfalt.
Die Fotos, die während der Begehung gezeigt wurden, belegen es deutlich: Unter den scheinbar chaotisch gestapelten Baumruinen keimt und gedeiht die Naturverjüngung. Pflanzen, Pilze, Insekten und Vögel finden hier Rückzugsräume, Brutplätze und Nahrung. Fachlich gilt: Ab etwa 50 Festmetern Totholz pro Hektar können sich viele dieser Arten gut entwickeln. Im Wildnisgebiet Dürrenstein-Lassingtal wurde ein Vielfaches davon gemessen – rund 280 Festmeter pro Hektar. Ein ökologischer Schatz, der sich nicht mit den Maßstäben der forstlichen Nutzung messen lässt.
Borkenkäfer – hier regelt das die Natur
Auch die dynamischen Entwicklungen auf ehemaligen Borkenkäferflächen sorgten für Diskussionsstoff. Während in Wirtschaftswäldern oft rasch eingegriffen wird, um die weitere Ausbreitung der Käfer zu verhindern, setzte man hier auf Geduld – und auf Vertrauen in natürliche Prozesse. Ursprünglich bestand die Befürchtung, dass die Käferpopulationen sich bis zu den angrenzenden Wirtschaftswäldern ausbreiten könnten. Doch das Gegenteil war der Fall: Die befürchtete Ausbreitung blieb aus.
.
© 2025 Adobe Stock, jonnysek
© 2025 Adobe Stock, Reinhold Schrank/imageBROKER
Fichten, Tannen, Buchen – und Großraubtiere
Vegetationskundlich dominiert im Wildnisgebiet ein typischer Fichten-Tannen-Buchenwald, ergänzt durch Lärche und Bergahorn – ein für mitteleuropäische Gebirgslagen charakteristisches Bild. Doch nicht nur die Pflanzenwelt wurde thematisiert: Auch große Beutegreifer wie Bär, Luchs und Wolf kamen zur Sprache – vor allem im Hinblick auf Wilddichte und Populationsmanagement. Denn diese wirken sich nicht nur auf die Naturverjüngung aus, sondern stellen langfristig auch die Lebensgrundlagen der großen Beutegreifer infrage.
.
Viel Wissen, kein Tourismus
Die Ziele des Wildnisgebiets wurden von den Vortragenden klar umrissen: Vorrang hat der Erhalt und – wo möglich – die Ausweitung dieser streng geschützten Flächen. Forschung spielt dabei eine zentrale Rolle, ebenso wie die Vermittlung von Wissen. Mit dem “Haus der Wildnis” in Lunz am See wurde ein Ort geschaffen, der Besucher:innen Einblick in die ökologischen Zusammenhänge des Wildnisgebiets gibt – ohne dass das Gebiet selbst touristisch genutzt wird. Führungen ins Innere des Gebiets bleiben wenigen, gezielt ausgewählten Anlässen vorbehalten.
Diese bewusste Zurückhaltung ist Ausdruck eines klaren Selbstverständnisses: Das Wildnisgebiet soll kein Erlebnispark sein, sondern ein stiller Referenzraum. Ein Ort, an dem die Natur noch ganz sie selbst ist.
© 2025 Susanna Teufl
© 2025 Susanna Teufl
Warum der Urwald Rothwald so wertvoll ist
Einen besonderen Stellenwert innerhalb des Gebiets nimmt der sogenannte “Urwald „Rothwald“ ein. Er zählt zu den letzten echten Urwäldern Mitteleuropas – ein Ort, an dem seit Jahrhunderten keine forstliche Nutzung stattgefunden hat. Gerade in einer Zeit, in der intakte Ökosysteme weltweit unter Druck stehen, kommt ihm eine unschätzbare Bedeutung zu. Er dient als „Null-Fläche“ – als unbeeinflusstes Vergleichsobjekt, das Rückschlüsse auf natürliche Waldentwicklung ermöglicht. Ein lebendiges Archiv, das in Zeiten des Klimawandels umso wichtiger wird.
Mehrmals wurde im Verlauf der Exkursion betont, wie wichtig solche Gebiete für die Wissenschaft, aber auch für das forstliche Selbstverständnis sind. Denn nur wenn wir wissen, wie Wälder ohne menschliche Eingriffe funktionieren, können wir beurteilen, wie naturnah heutige Wirtschaftswälder tatsächlich sind.
„Da es weltweit nur selten wirkliche Urwälder mehr gibt, kann man auch wenig über die natürliche Entwicklung der Wälder sagen. Deshalb sind diese Gebiete als „Null-Fläche“ unbedingt zu erhalten und zu schützen“, resümiert Ing. Susanna Teufl von der Niederösterreichischen Landes-Landwirtschaftskammer.
Zum Weiterlesen
Zum Nachlesen
Rechte & Produktion
© 2024 Die österreichischen Familienwaldbetriebe & Österreichischer Forstverein – Unterstützt durch den Holzinformationsfonds der Landwirtschaftskammer Österreich
Redaktion
Wir haben sorgfältig recherchiert und Informationen zusammengetragen. Wenn ihnen dennoch etwas auffällt, was sie ändern würden oder etwas zu ergänzen wäre, bitten wir sie, Kontakt mit uns aufzunehmen. Wir freuen uns über ihre Rückmeldung und Anregungen.