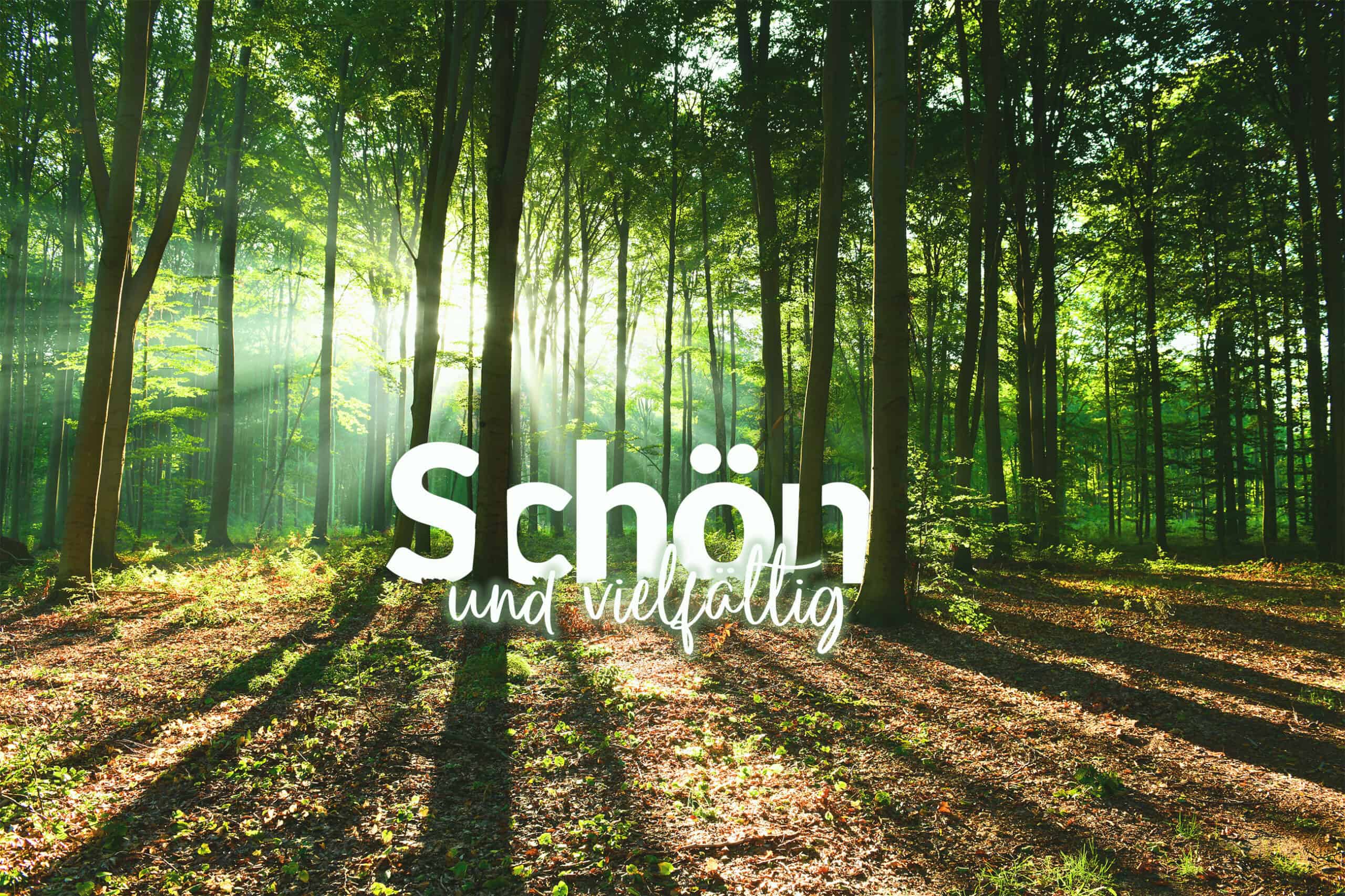Der Begriff „Biodiversität“ ist aus öffentlichen Debatten nicht mehr wegzudenken. Doch während er vielerorts als neues Trendwort auftaucht, gehört er für viele Waldbesitzer:innen längst zum Alltag – als Teil einer verantwortungsvollen, naturnahen Bewirtschaftung.
Mehr als ein Schlagwort – Zahlen, die für sich sprechen
Die Österreichische Waldinventur zeigt eine erfreuliche Entwicklung: Seit den 1960er-Jahren hat sich etwa der Totholzvorrat verdreifacht. Auch Strukturreichtum und Artenvielfalt sind vielerorts gestiegen – ein Ergebnis bewusster Pflege und Weitsicht. Denn klar ist: Ein vielfältiger Wald ist widerstandsfähiger gegen Stürme, Schädlinge und Klimastress – und damit zukunftssicher.
Die Klimakrise als zentrale Herausforderung der Waldbiodiversität
Trotzdem ist der Weg zum biodiversitätsreichen Wald kein Selbstläufer. Die Klimakrise verändert Lebensräume schnell und tiefgreifend – viele Arten geraten unter Druck, Rückzugsräume schrumpfen. Nur mit konsequentem Klimaschutz und aktiver, anpassungsfähiger Waldbewirtschaftung lassen sich stabile Lebensräume bewahren.
Wenn Begriffe trennen, obwohl Ziele verbinden
Ein Stolperstein in der Diskussion: die Sprache. Während Förster:innen von Altbäumen sprechen, sagen andere Habitat- oder Biotopbäume. Obwohl das Ziel oft das gleiche ist, führt die unterschiedliche Wortwahl zu Missverständnissen. Mehr gegenseitiges Verständnis – auch sprachlich – schafft hier die Basis für gemeinsame Lösungen.
Fazit: Biodiversität braucht Dialog
Biodiversität ist kein Modethema, sondern seit Jahrzehnten gelebte Realität in vielen Wäldern. Wer das anerkennt, öffnet die Tür für einen konstruktiven Dialog – im Sinne des Waldes, der Artenvielfalt und des Klimaschutzes.
Waldgeschichten auf Facebook folgen
Waldgeschichten auf Instagram folgen
Waldgeschichten auf LinkedIn folgen
Waldgeschichten auf YouTube sehen