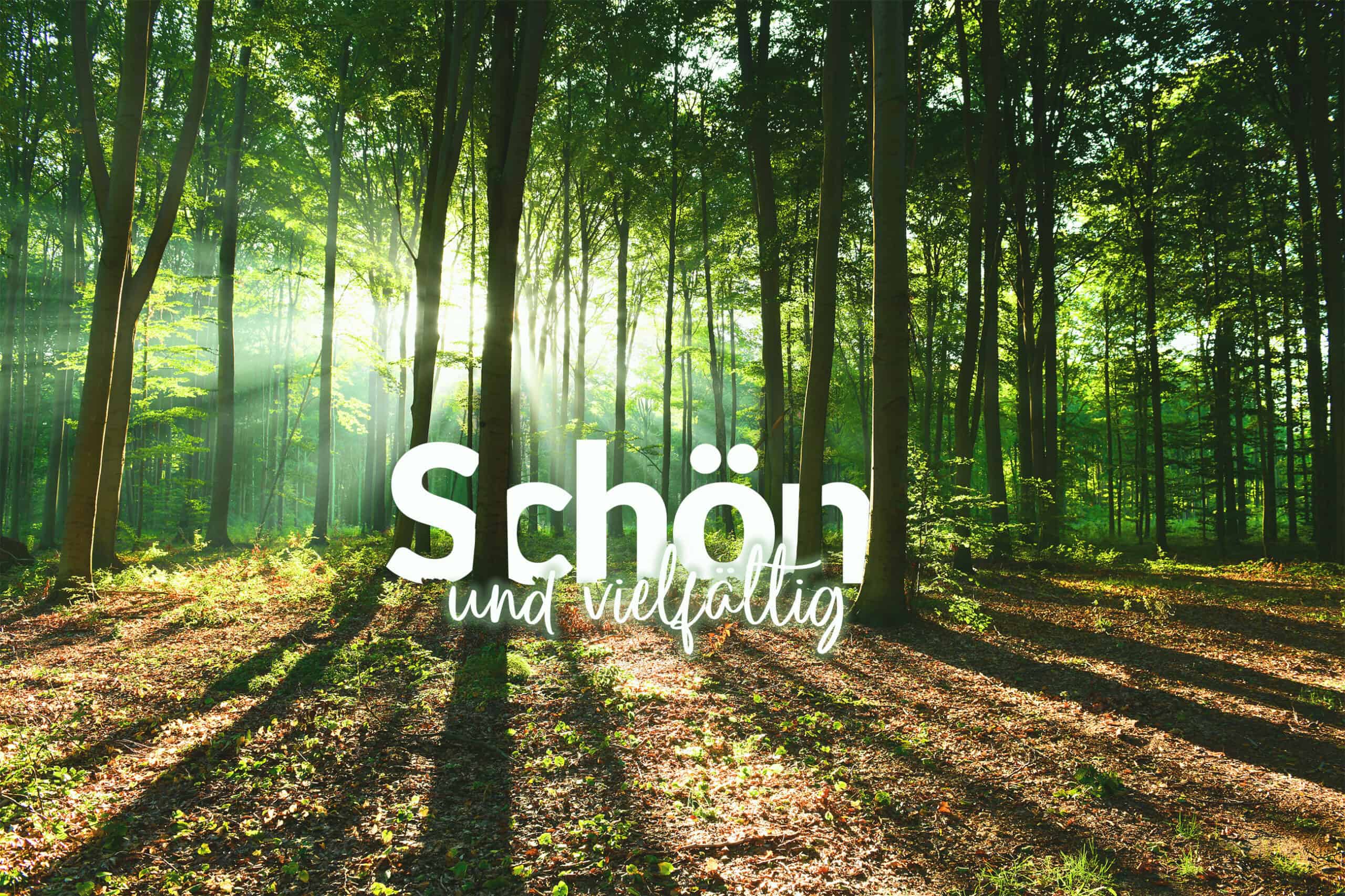Mit nachhaltigen Nichtholzprodukten Erträge steigern und Biodiversität fördern
Österreichs Wälder liefern weit mehr als Bau- und Brennholz. Nichtholzprodukte (NWFP, Non-Wood Forest Products) – auch Waldnebenprodukte genannt –, umfassen Laub, Knospen, Baumfrüchte, Reisig, Baumwasser und Harze. Diese Ressourcen wurden in der traditionellen Forst- und Landwirtschaft vielfältig genutzt und erfahren heute ein Comeback – sowohl ökologisch als auch wirtschaftlich.
Frischlaub und Falllaub in der Viehwirtschaft
- Historische Praxis: Früher war die Schneitelung (regelmäßiger Rückschnitt von Eschen, Linden, Hainbuchen zur Gewinnung von Laubheu als Viehfutter) üblich. Heute weiß man: Übermäßiges Schneiteln schwächt die Bäume und entzieht dem Wald Nährstoffe. Auch die Streunutzung, also die Entnahme von Laub vom Waldboden, ist forstgesetzlich verboten, weil auch sie dem Wald wichtige Nährstoffe entzieht. Beide historischen Praktiken haben zu langfristigen Waldschäden geführt, mit deren Folgen Waldbesitzer:innen bis heute kämpfen.
- Heutiger Nutzen: Bio-Laubfutter kann bei Wiederkäuern die Mineralstoffversorgung verbessern.
- Rechtlich zulässige Nutzung: Für den privaten Eigenbedarf dürfen geringe Mengen Frischlaub von Ästen (ohne die Bäume zu schädigen) und kleine Mengen Falllaub vom eigenen Grund oder mit Erlaubnis des Waldbesitzers gesammelt werden. Größere oder gewerbliche Entnahmen sind verboten (s. Forstgesetz §38).
Speiselaub und Fermentation: Vergessene Nahrungsquelle
Bis ins 19. Jahrhundert gehörte Speiselaub zur Grundversorgung in Österreich. Junge Blätter wurden:
- roh gegessen (z. B. zarte Lindenblätter, säuerliche Buchenblätter),
- getrocknet & gemahlen (Streckmehl für Brot),
- fermentiert (Blatt-Sauerkraut ähnlich wie Kohlgemüse).
Moderne Chancen
- Premium-Produkte für Gastronomie & Feinkost.
- Verwertung der Produkte als regionale Spezialitäten.
Knospen- und Reisignutzung
- Knospen und junge Zweige können – in kleinen Mengen und schonend entnommen –, für Tee, Naturmedizin oder als Ausgangsstoff für Naturkosmetik genutzt werden.
- Marktpotenzial: Bio-Knospenextrakte erzielen im Direktvertrieb oder über Apotheken hohe Preise.
Tipp: Nur an gesunden Bäumen ernten, nicht an Jungwuchs oder Schutzbäumen.
Baumfrüchte und Wildobst
- Esskastanie, Haselnuss, Walnuss, Wildkirsche oder Hagebutten können gesammelt und vermarktet werden.
- Nutzungsmöglichkeiten: Direktvermarktung, Feinkost, Gastronomie.
Harze und Baumwasser
- Harzgewinnung (z. B. von Lärche oder Fichte) für Naturkosmetik oder Duftprodukte.
- Birken- oder Ahornwasser als Spezialität für Getränkeherstellung.
- Wichtig: Nur mit fachgerechten Methoden, um den Baum nicht zu schädigen.
Pilze, Beeren, Wildkräuter
- Heidelbeeren, Preiselbeeren, Holunder, Schwammerl sind beliebt bei der Direktvermarktung oder als Zutat für regionale Gastronomie.
Wichtig: Sammeln nur auf eigenen Flächen oder mit Erlaubnis des Waldeigentümers.
Hinweis: Vor jeglicher Nutzung müssen rechtliche Bestimmungen geprüft und gegebenenfalls Genehmigungen eingeholt werden
Rechtliche Rahmenbedingungen in Österreich
Forstgesetz 1975 (§ 38) Streugewinnung: “(1) Bodenstreu, wie Laub- oder Nadelstreu u. dgl., darf nur unter Schonung des Waldbodens gewonnen werden. Die Gewinnung von Rechstreu ist nur mit Holzrechen und auf derselben Stelle höchstens jedes vierte Jahr zulässig. In Wäldern, deren Böden zur Verarmung neigen, in Schutzwäldern sowie auf Waldflächen, auf denen die Streunutzung die Wiederbewaldung gefährden würde, ist die Gewinnung von Bodenstreu gänzlich untersagt.
(2): Die Aststreugewinnung an stehenden Bäumen (Schneiteln) ist verboten.”
Das gewerbliche Sammeln von Waldnebenprodukten erfordert stets die Zustimmung des Waldeigentümers.
Waldgeschichten auf Facebook folgen
Waldgeschichten auf Instagram folgen
Waldgeschichten auf LinkedIn folgen
Waldgeschichten auf YouTube sehen