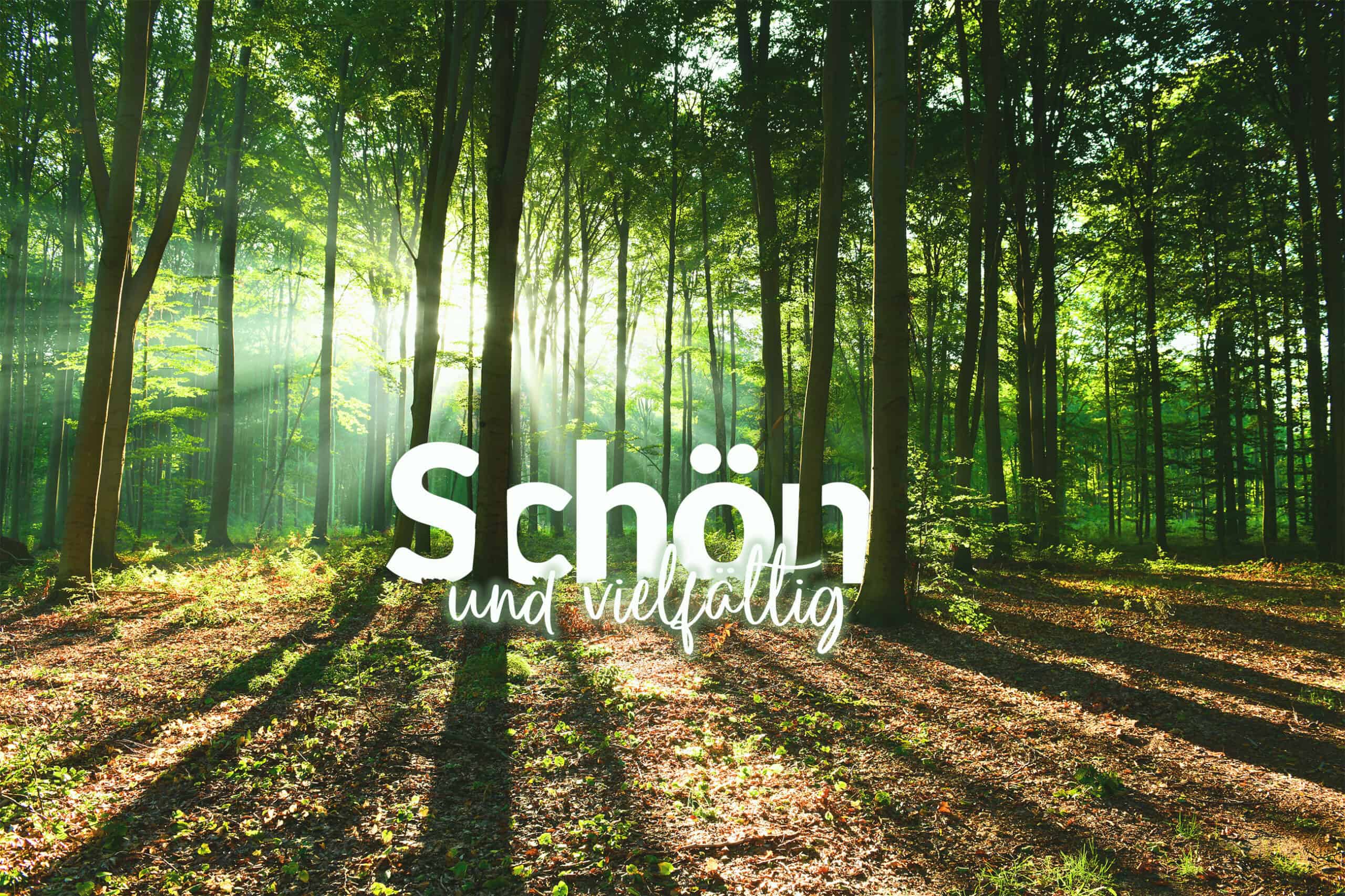© 2025 Adobe Stock, nullplus
Ob als Schutz vor Lawinen und Muren, als Luft- und Wasserspeicher oder als Rückzugsort für bedrohte Arten – unsere heimischen Wälder leisten weit mehr, als Holz zu liefern. In Tirol, wo über 40 Prozent der Fläche bewaldet sind, wird dieser Mehrwert besonders sichtbar. Doch die Herausforderungen durch Klimakrise, Schädlinge und Extremwetter nehmen zu. Die neue Biodiversitätsleitlinie, entwickelt im Rahmen des Programms „Klimafitter Bergwald Tirol“ der Tiroler Landesregierung, zeigt, wie Wälder widerstandsfähiger werden – durch Artenvielfalt, naturnahe Bewirtschaftung und den Erhalt genetischer Ressourcen. Ein Weg, der beispielhaft für ganz Österreich steht.
Tiroler Ziele bis 2050
• Tirols Biodiversitätsindex Wald auf dem bestehenden hohen Niveau halten bzw. erhöhen
• Bewirtschaftung der Wälder primär auf Grundlage der Waldtypenkarte Tirol
• Herstellung eines tragbaren Wildeinflusses auf der Fläche
• Sicherung wertvoller Waldgesellschaften in Form von Naturwald-Reservatfläche
• Artenreichtum und Totholzreichtum fördern
• Ausbau der anerkannten und zertifizierten Saatgutbestände
• Erhalt und Vernetzung der Naturwaldreservatflächen vorantreiben
• Habitatkontinuität gewährleisten
© 2025 Adobe Stock, medwedjafamveldman
Warum jetzt gehandelt werden muss
Die Klimakrise stellt unsere Wälder vor nie dagewesene Herausforderungen. Stürme, Trockenperioden und Schädlingsbefall nehmen zu. Gleichzeitig steht der Wald mehr denn je im Fokus, wenn es um Klima-, Arten- und Ressourcenschutz geht. In Tirol – wo mehr als 40 Prozent der Landesfläche bewaldet sind – reagiert man nun mit einem konkreten Maßnahmenpaket: der Biodiversitätsleitlinie für Tirols Wälder. Sie bietet einen neuen, praktikablen Rahmen für den Erhalt und die Förderung der biologischen Vielfalt im Wirtschaftswald – und ist damit richtungsweisend für ganz Österreich.
Was Biodiversität im Wald bedeutet
Biodiversität – das meint nicht nur eine große Zahl an Tier- und Pflanzenarten. Gemeint ist das Zusammenspiel von genetischer Vielfalt, Artenvielfalt und Vielfalt an Lebensräumen. Diese Vielfalt ist die Grundlage für stabile, widerstandsfähige Ökosysteme. Gerade Wälder mit hoher Struktur- und Artenvielfalt zeigen sich anpassungsfähiger gegenüber klimatischen Veränderungen. Sie speichern mehr Wasser, bieten Lebensraum für eine Vielzahl an Arten und können CO₂ effizient binden. Der Wald wird so nicht nur zum Klimaschützer – er wird selbst robuster.
© 2025 Adobe Stock, Malena
© 2025 Adobe Stock, Wolfgang Hauke
Der Zustand der Tiroler Wälder – und warum er nicht ausreicht
Tatsächlich stehen Tirols Wälder im bundesweiten Vergleich nicht schlecht da: Naturwaldreservate, hohe Totholzanteile und eine kleinteilige Bewirtschaftung sorgen für ein solides Niveau an Biodiversität. Doch wie die Auswertung des „Biodiversitätsindex Wald“ zeigt, besteht in bestimmten Bereichen akuter Handlungsbedarf. Der Klimawandel beschleunigt das Artensterben, auch in den Alpen. Besonders bedroht sind jene Arten, die auf kalte, hochalpine Lagen angewiesen sind – denn ihnen fehlt der Raum zum Ausweichen.
Was die Biodiversitätsleitlinie Tirol leistet
Mit der Biodiversitätsleitlinie schafft der Tiroler Landesforstdienst erstmals ein praxisnahes Werkzeug, das Biodiversität konsequent in die forstliche Planung und Bewirtschaftung integriert. Sie richtet sich an Waldbesitzer:innen, Forstpersonal und Entscheidungsträger:innen – also an alle, die Verantwortung für den Wald tragen.
Zentrale Maßnahmen der Leitlinie:
- Habitatbäume, Alt- und Totholz erhalten: Rund 30 % aller Waldarten sind auf Totholz angewiesen. Der Anteil soll künftig gezielt erhöht werden, auch durch gezielte Pflege alter Bäume.
- Waldränder aufwerten: Strukturreiche Waldränder bieten Rückzugsräume und verbinden Lebensräume. Ihre Förderung wirkt sich direkt positiv auf Insekten, Vögel und Kleinsäuger aus.
- Lebensräume vernetzen: Durch Programme wie connectforbio und Naturwaldzellen sollen bisher isolierte Rückzugsorte verbunden und neue geschaffen werden.
- Moore, Feuchtwälder und Auen schützen: Diese sogenannten „Hotspots der Biodiversität“ sollen erhalten und – wo möglich – renaturiert werden.
Vielfalt durch Waldumbau fördern: Die standortangepasste Mischung klimafitter Baumarten wird zum Leitprinzip einer biodiversitätsfördernden Forstwirtschaft.
© 2025 Adobe Stock, Sander Meertins
© 2025 Adobe Stock, Calado
Nachhaltige Nutzung und Artenvielfalt ergänzen sich
Ein zentrales Ziel der Leitlinie ist es, ökologische und ökonomische Interessen zu verbinden. Der Wald soll weiterhin als Rohstofflieferant dienen – allerdings im Rahmen einer nachhaltigen, vielfältigen und verantwortungsvollen Nutzung. Das bedeutet: Holz aus Tirol, gewonnen in biodiversitätsfreundlicher Bewirtschaftung, ist ein wertvoller Beitrag zum Klimaschutz. Denn wer Holz dort erntet, wo es nachwächst, spart CO₂ und schont globale Ressourcen.
Verantwortung für kommende Generationen
Die Biodiversitätsleitlinie stellt klar: Ein artenreicher Wald ist nicht nur ein Naturschutzanliegen, sondern auch eine Versicherung gegen zukünftige Krisen. Denn stabile, resiliente Wälder können Wetterextreme besser abfedern, natürliche Schutzfunktionen wie Lawinen- oder Erosionsschutz aufrechterhalten – und gleichzeitig Lebensraum für zahlreiche Arten bieten.
Bildung, Beratung, Förderung: So wird Umsetzung möglich
Um Waldbesitzer:innen die Umsetzung zu erleichtern, sieht die Leitlinie umfangreiche Beratungsangebote und finanzielle Förderungen vor. Vom Belassen einzelner Habitatbäume bis zur Pflege artenreicher Waldränder – für viele Maßnahmen stehen gezielte Unterstützungen bereit. Zusätzlich wird in der Aus- und Weiterbildung des forstlichen Fachpersonals angesetzt, damit Biodiversität in der Praxis nicht Theorie bleibt.
.
© 2025 Adobe Stock, ARochau
© 2025 Adobe Stock, Anja Götz
Tirol als Modellregion – und Vorbild für andere Bundesländer
Mit der Biodiversitätsleitlinie geht Tirol einen Schritt, der auch für andere Regionen Vorbild sein kann. Denn viele Herausforderungen sind nicht regional begrenzt. Die Klimakrise und das Artensterben machen vor Landesgrenzen nicht halt. Was heute in Tirol erprobt wird, kann morgen in der Steiermark, in Niederösterreich oder im Burgenland übernommen werden. Die naturnahe Bewirtschaftung und der Schutz vielfältiger Lebensräume sind zentrale Bausteine für einen zukunftsfähigen Wald – überall in Österreich.
Fazit
Biodiversität im Wald ist kein „Nice-to-have“, sondern überlebenswichtig – für das Ökosystem, für den Klimaschutz und für die Menschen. Mit der Biodiversitätsleitlinie schafft Tirol konkrete Grundlagen, wie sich Vielfalt, Nutzung und Verantwortung in Einklang bringen lassen. Jetzt kommt es darauf an, dass möglichst viele diesen Weg mitgehen – im bewirtschafteten Wald, beginnend in der Ausbildung.
© 2025 Adobe Stock, Wolfgang Hauke