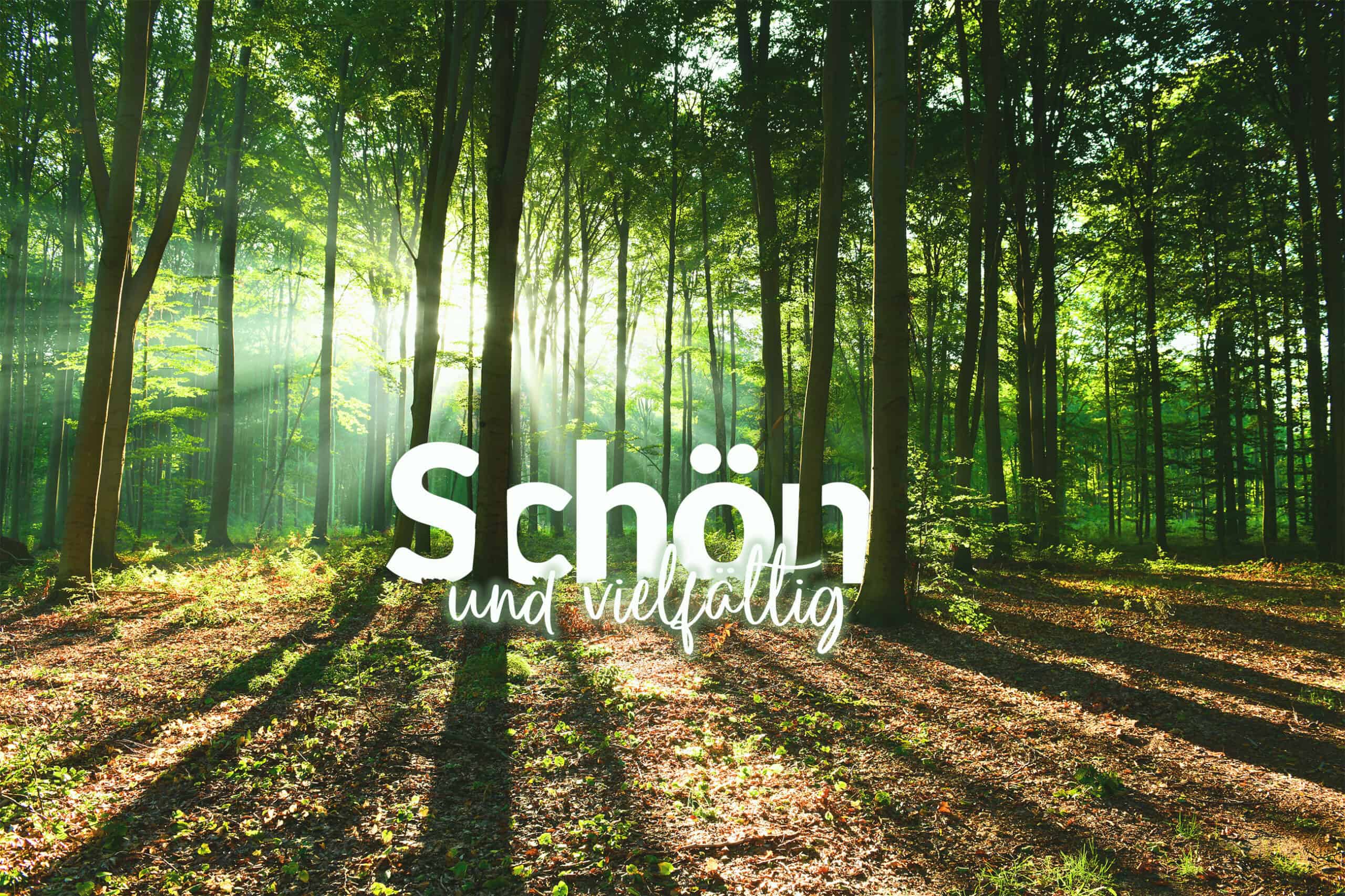© 2025 Adobe Stock, visualpower
Seit nahezu 20 Jahren kämpft Österreichs Forstwirtschaft gegen das Eschentriebsterben. Nun gibt es Hoffnung: Das Projekt “Esche in Not” hat erfolgreich krankheitstolerante Bäume gezüchtet, die den Weg für die Rückkehr dieser wichtigen Baumart ebnen. Im September 2025 findet ein Thementag zur Eschenerhaltung statt, bei dem aktuelle Forschungsergebnisse präsentiert und praktische Maßnahmen diskutiert werden.
Das von zahlreichen Institutionen geförderte Projekt “Esche in Not” zeigt: Mit wissenschaftlicher Präzision, breiter Unterstützung und langem Atem kann die Esche gerettet werden. Die Forscher, darunter Dr. Heino Konrad (Bundesforschungszentrum für Wald, BFW), sind zuversichtlich, dass die Esche als Waldbaumart wieder ihren früheren Stellenwert erreichen wird.
© 2025 Adobe Stock, Maria Brzostowska
Die Bedrohung durch einen eingeschleppten Pilz
Die Gemeine Esche steht vor einer existenziellen Bedrohung: Ein aus Ostasien eingeschleppter Schlauchpilz mit dem deutschen Namen „Falsches Eschen-Stengelbecherchen“ verursacht das sogenannte Eschentriebsterben. Die Krankheit zeigt sich durch absterbende Blätter, Triebe und Kronenteile sowie Nekrosen am Stammfuß und Wurzelhals. Besonders gefährlich: Durch diese Schädigungen können Holzfäuleerreger eindringen und die Bäume destabilisieren.
Das Ausmaß der Katastrophe ist dramatisch. Eine geregelte Forstwirtschaft mit Eschen ist in Österreich kaum mehr möglich, die Baumart wird zunehmend gefährdet. Doch die Natur selbst zeigt einen Ausweg: In stark befallenen Beständen finden sich immer wieder einzelne Eschen, die keine oder nur wenige Symptome an verholzten Teilen zeigen. Diese natürlich toleranten Bäume sind der Schlüssel zur Rettung der Art.
Projekt “Esche in Not”: Ein Rettungsplan nimmt Gestalt an
2015 startete das Bundesforschungszentrum für Wald (BFW) gemeinsam mit der Universität für Bodenkultur Wien (BOKU) die Initiative “Esche in Not”. Das ehrgeizige Ziel: krankheitstolerante Eschen in ganz Österreich aufspüren, vermehren und züchten, um die genetische Vielfalt der Baumart zu erhalten.
Die Dimension des Projekts ist beeindruckend: In den Jahren 2015 und 2017 sammelte das Team mit Unterstützung der forstlichen Praxis Saatgut von rund 700 Mutterbäumen aus allen Bundesländern. Daraus zogen sie über 35.000 Jungpflanzen im Versuchsgarten des BFW in Tulln heran, also durchschnittlich 50 Nachkommen pro Mutterbaum.
Diese Nachkommen wurden auf vier Versuchsflächen ausgepflanzt und dort bewusst dem natürlichen Infektionsdruck ausgesetzt. Um aussagekräftige Ergebnisse zu erhalten, verteilte das Team die Pflanzen gleichmäßig auf drei Blöcke und ordnete sie innerhalb jedes Blocks zufällig an – eine logistische Meisterleistung. Nach einem Wuchsjahr begannen die jährlichen Bewertungen, des Krankheitsverlauf. Erfasst wurde die Intensität des Triebsterbens von 0 % (“kein Triebsterben”) bis 100 % (“Pflanze abgestorben”).
Foto: Team des BFW bei der Anlage der neuen Eschen-Tieflagen-Samenplantage am Standort Feldkirchen/Donau (Oberösterreich)
.
© 2025 BfW
© 2025 T. Thalmayr, G. M. Unger
Beeindruckende Erfolge und genetische Erkenntnisse
Die Ergebnisse nach Abschluss aller Bewertungen im Herbst 2023 übertreffen die Erwartungen: Auf allen vier Teilflächen waren nach dreijähriger Beobachtung noch rund 20 Prozent der Nachkommen völlig frei von Schädigungen durch das Eschentriebsterben. Das Team sicherte 1.015 ungeschädigte Nachkommen von 439 Mutterbäumen mit ausgezeichneten Wuchs- und Formeigenschaften durch Pfropfung in einem Klonarchiv in Tulln. Parallel vermehrten sie diese Pflanzen vegetativ über Stecklinge für Waldversuche.
Besonders wertvoll sind die genetischen Erkenntnisse aus der Untersuchung von 1.096 Nachkommen mittels sogenannten SNP-Array-Analysen, modernen DNA-Untersuchungsmethoden. Die Wissenschaftler entdeckten deutliche genetische Unterschiede: Eschen aus Vorarlberg und dem Westen Nordtirols unterscheiden sich stark von jenen im übrigen Österreich. Auch Temperatur und Niederschlagsverteilung prägen die genetische Ausstattung der Populationen.
Diese Erkenntnisse führten zu einer maßgeschneiderten Strategie mit drei spezialisierten Klon-Kollektiven: eines für Vorarlberg (50 Klone), eines für höhere Lagen über 600 Meter Seehöhe (167 Klone) und eines für Tieflagen unter 600 Meter (270 Klone). Ausgewählt wurden nur Klone, deren Mutterbäume mehr als 25 Prozent Nachkommen ohne Krankheitssymptome hervorbrachten.
Foto: Drohnenaufnahme der Teilversuchsflächen R1 bis R4 im BFW-Versuchsgarten (Tulln, NÖ)
Der Weg zurück in den Wald
Im Frühling 2024 begann schließlich die konkrete Umsetzung: Die Tieflagen-Plantage entstand in Feldkirchen an der Donau in Kooperation mit der Landesforstdirektion Oberösterreich, die Plantage für Vorarlberg in Rankweil. Im Herbst 2024, zum Abschluss der Phase II, legten die Forscher die Hochlagen-Plantage bei Nörsach in Kooperation mit dem Landesforstgarten Tirol an. Mit ersten ertragreichen Saatguternten rechnen die Experten in etwa zehn Jahren.
Parallel laufen Versuche auf Waldstandorten. Die erste Versuchsfläche bei Asten wurde bereits im Herbst 2023 etabliert. Dort wird unter hohem Infektionsdruck getestet, ob die ausgewählten Klone ihre Toleranz bewahren. Zusätzliche künstliche Infektionsversuche mit dem Eschentriebsterben-Erreger und dem Gelbschuppigen Hallimasch prüfen die Widerstandskraft der Klone noch eingehender.
Abbildung: Relativer Anteil an Nachkommen in den einzelnen Klassen der Triebsterbensintensität (% Schädigung durch das Eschentriebsterben) in den Resistenztests R1 bis R4 im BFW-Versuchsgarten. Auf jeder Teilversuchsfläche wurden die Schadansprachen in drei aufeinanderfolgenden Jahren, beginnend ein Jahr nach der Anlage, durchgeführt (z. B: Teilfläche R1: Anlage: 2017; Schadansprachen 2018, 2019 und 2020).
© 2025 Adobe Stock, mdyn
© 2025 Adobe Stock, tibor13
Ein Apell an die Praxis und Ausblick
Nach dem Ende der Phase II (2019-2024) gehen die Arbeiten weiter. Die Plantagen und Versuchsflächen werden kontinuierlich beobachtet, auch hinsichtlich des Geschlechts der Bäume. Die Stecklingsvermehrung soll fortgesetzt werden, um der forstlichen Praxis kurzfristig Vermehrungsgut bereitzustellen.
Das Projektteam appelliert eindringlich an alle Waldbesitzer und Forstleute, gering geschädigte Eschen in Ihren Beständen zu erhalten und zu fördern. Diese Bäume sind wertvolle Gen-Reservoire. Ihre natürliche Verjüngung sollte gezielt ermöglicht werden, um die Bemühungen zur Erhaltung der Baumart zu unterstützen.
Übrigens: Im Rahmen des Thementags am 4. September 2025 in der FAST Ossiach zum Thema gibt es im Rahmen einer Exkursion eine spektakuläre seilunterstützte Fällung zu sehen.
Zum Weiterlesen
Zum Nachlesen
Rechte & Produktion
© 2024 Die österreichischen Familienwaldbetriebe & Österreichischer Forstverein – Unterstützt durch den Holzinformationsfonds der Landwirtschaftskammer Österreich
Redaktion
Wir haben sorgfältig recherchiert und Informationen zusammengetragen. Wenn ihnen dennoch etwas auffällt, was sie ändern würden oder etwas zu ergänzen wäre, bitten wir sie, Kontakt mit uns aufzunehmen. Wir freuen uns über ihre Rückmeldung und Anregungen.