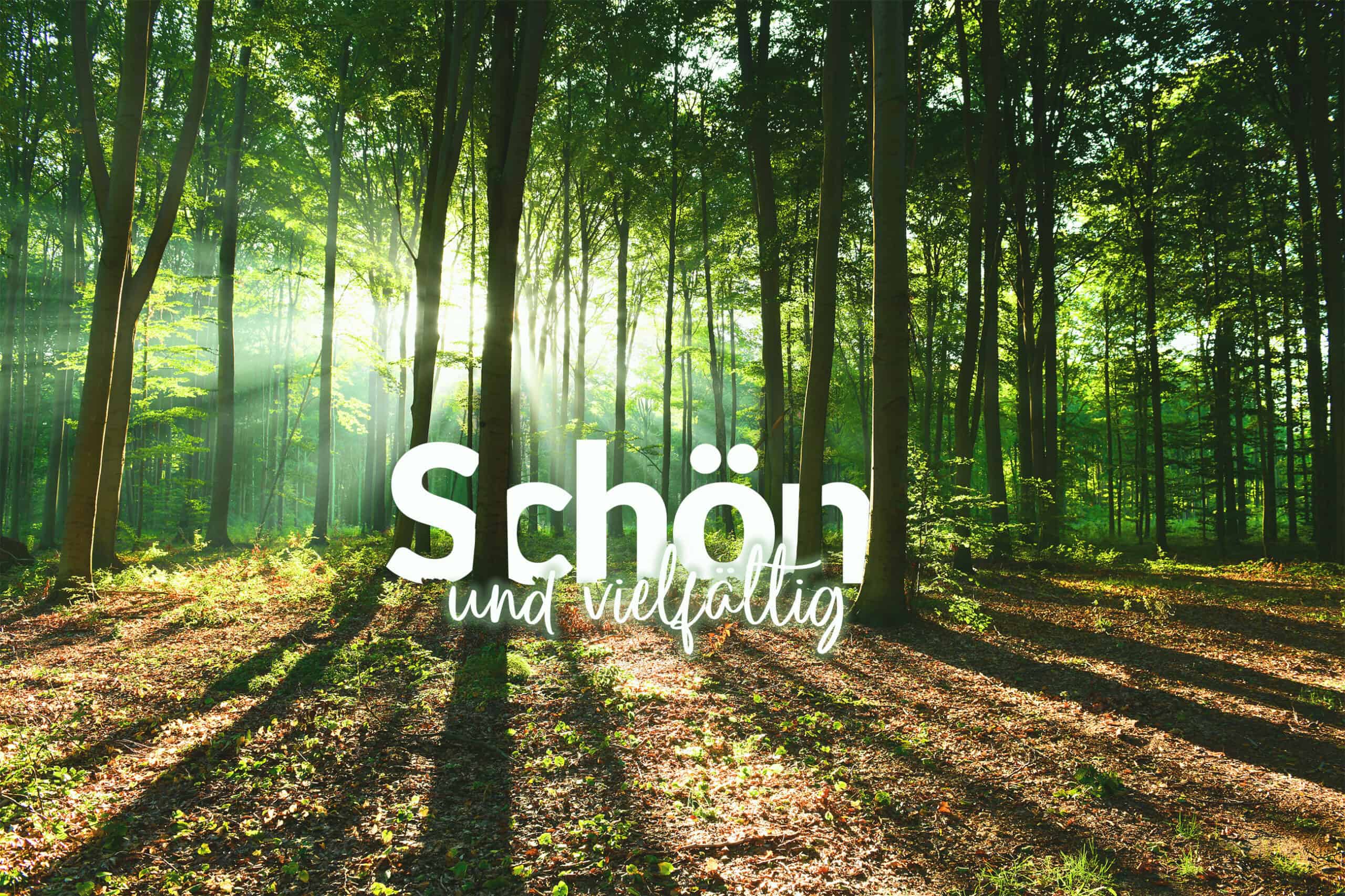© 2025 Adobe Stock, natagolubnycha
Schutzwälder sind zentrale Elemente des alpinen Bevölkerungsschutzes. Rund 42 % der österreichischen Wälder gelten als Schutzwald. Ihre Funktion: Schutz vor Lawinen, Steinschlag, Muren und Erosion. Doch durch Klimawandel, Schadereignisse und Wilddruck stehen Schutzwälder unter massivem Druck. Für Waldbesitzer:innen und Forstfachleute bedeutet das: Strategisch planen, schnell handeln und kontinuierlich pflegen – mit den richtigen Instrumenten und Partnern.
Schutzwald in Österreich
Ein Schutzwald ist laut § 21 Forstgesetz ein Bestand, der durch seine Lage oder Beschaffenheit Schutzwirkungen entfaltet – entweder für den Standort selbst (Standortschutzwald) oder für darunterliegende Objekte (Objektschutzwald). Ein intakter Schutzwald ist keine Naturkonstante, sondern das Ergebnis kontinuierlicher Pflege und kluger waldbaulicher Entscheidungen.
© 2025 Adobe Stock, luftklick
Aktuelle Entwicklung
Das Bearbeiten von Schadholz durch Windwurf, Schneebruch und Borkenkäfer zählt zu den größten Aufgaben der österreichischen Forstwirtschaft. In Osttirol haben sich die Borkenkäferschäden in den vergangenen Jahren dramatisch entwickelt, 2023 haben sie historische Dimensionen errreicht. Zusammen mit weiteren Schadholzmengen durch Sturm- und Schneebruchholz in besonders betroffenen Regionen stellt dies eine enorme Herausforderung dar. Das Ausmaß verdeutlicht die Dringlichkeit: Nur durch rasche Aufarbeitung, gezielte Wiederbewaldung und wirksamen Forstschutz kann die Schutzfunktion des Waldes langfristig gesichert werden.
Die mechanische Entrindung als Schadholzbehandlung erhält verstärkte Unterstützung durch den österreichischen Waldfonds. Mit einer Förderung von 80 Prozent der anrechenbaren Kosten können Waldbesitzer:innen effektive Borkenkäfer-Prävention umsetzen und ihre Bestände schützen.
Der Planungsschutz für Schutzwälder wurde 2025 durch neue WLV-Richtlinien (Wildbach- und Lawinenverbauung) für Vorprojekte und Wildschutzmaßnahmen erweitert. Diese Richtlinien bieten Waldbesitzern einen klaren Rahmen für nachhaltige Schutzwaldbewirtschaftung.
Als zentrale Informationsbasis steht die Hinweiskarte Schutzwald zur Verfügung. Diese digitale Karte ist über die WALDATLAS-Plattform kostenlos zugänglich und zeigt österreichweit alle Schutzwaldflächen. Parallel läuft die kontinuierliche Gefahrenzonen-Planung zur Risikobewertung.
Die Kooperation zwischen WLV und Gemeinden wird durch Digitalisierung des Gefahrenmanagements gestärkt. Online-Plattformen ermöglichen effizientere Zusammenarbeit bei Schutzwald-Projekten und Naturgefahren-Prävention. Dazu zählt beispielsweise das Gemeindeportal der WLV, eine App für Wildbachbetreuer, das digitale Wildbach- und Lawinenkataster bei waldatlas.at. Unter naturgefahren.at gibt’s außerdem Aktuelles zu Monitoring- und Frühwarnsystemen.
Nach Schadereignissen zählt jede Saison
Windwurf, Schneedruck und Borkenkäfer haben in vielen Regionen große Kahlflächen hinterlassen. Der Erhalt der Schutzfunktion ist zeitkritisch: Wurzelstöcke bieten nur wenige Jahre Stabilität, bevor sie verrotten und die Gefahr für Rutschungen und Lawinen deutlich steigt.
Empfohlene Schritte:
- Schnelle Schadholz-Aufarbeitung zur Reduktion des Borkenkäferdrucks.
- Standortgerechte Planung der Wiederaufforstung mit klimafitten Baumarten.
- Zusammenarbeit mit Forstbehörden und der Wildbach- und Lawinenverbauung (WLV).
Förderung: Der Waldfonds sowie Landesprogramme unterstützen Wiederbewaldung und zum klimaresilienten Waldumbau auch im Jahr 2026. Es empfiehlt sich, Anträge zeitnah zu stellen.
© 2025 Adobe Stock, R-Film
© 2025 Adobe Stock, matousekfoto
Förderung und Gefahrenzonenplanung
Der Waldfonds unterstützt gezielte Forstschutzmaßnahmen gegen Borkenkäferbefall. Die mechanische Entrindung von Schadholz am Waldort oder im Trockenlager beispielsweise wird mit bis zu 80 % der anrechenbaren Kosten gefördert (Maßnahme M5).
Förderdetails M5:
- Mindestfördersumme: 1.000 Euro
- Ziel: Verhinderung der Vermehrung rindenbrütender Insekten
WLV-Richtlinie 2025: Planungssicherheit für Vorprojekte
Die Wildbach- und Lawinenverbauung WLV hat 2025 eine technische Richtlinie veröffentlicht, die festlegt, wie Vorprojekte zur Schutzwaldsanierung strukturiert werden müssen. Dazu zählen Planung, Wildschutz, Freistellung und Dokumentation.
Zusätzlich erstellt die WLV Aktionsprogramme wie „Wald schützt uns!“ mit Empfehlungen zur Klimaanpassung. Gemeinden werden gezielt eingebunden, um Gefahrenzonenplanung, Aufforstung und technische Sicherungen besser zu koordinieren.
Digitale Werkzeuge für Planung und Umsetzung
Zur Entscheidungsunterstützung stehen Waldbesitzern mehrere kostenfreie Tools zur Verfügung:
Digitale Karten und Daten
- waldatlas.at: Geodatenplattform mit Schutzwaldkarten, nutzbar am PC oder mobil
- klimafitterwald.at/baumarten: Baumartenampel des BFW zur klimafitten Baumartenwahl
Funktionen
- Standortanalyse nach Wuchsgebiet, Höhenlage, Exposition.
- Visualisierung von Schutzwaldstatus und Gefahrenzonen.
- Planung, Mess- und Zeichenwerkzeuge für Kulturplanung und Dokumentation.
© 2025 Adobe Stock, arkadijschell
© 2025 Adobe Stock, arkadijschell
Standortgerechte Baumartenwahl
Die Wahl geeigneter Baumarten ist entscheidend für die Resilienz des Schutzwaldes. Reine Fichtenbestände gelten als anfällig. Mischbestände mit strukturreichem Aufbau werden empfohlen, abhängig von Wuchsgebiet, Höhenlage und Exposition.
Typische Optionen (standortspezifisch):
- Nadelhölzer: Tanne, Lärche; in Hochlagen teils Zirbe.
- Laubhölzer: Buche (lagenabhängig), Bergahorn, Eiche in wärmeren Lagen.
- Pionierarten: Vogelbeere, Birke.
- Douglasie nur nach Eignungsprüfung und außerhalb klassischer Hochlagen-Schutzwälder.
Die Baumartenampel liefert eine standortbasierte Eignungsbewertung (grün = hoch, gelb = mäßig, rot = ungeeignet).
Siehe auch: Assisted Migration
Angepasste Baumarten-Zusammensetzung und standortgerechte Herkünfte können helfen, die Kohlenstoffsenke europäischer Wälder unter dem Klimawandel zu erhalten – allerdings nicht unbegrenzt und in Abhängigkeit vom Standort-/Managementkonzept.
Tipp für Waldbewirtschaftende in der Steiermark:
Das Projekt FORSITE – Waldtypisierung Steiermark liefert für die standortgereichte Baumartenwahl ein wertvolles Werkzeug. Wer jetzt pflanzt oder verjüngt, kann mit dem Tool die passende Baumart für den Standort und das künftige Klima auswählen und so langfristig stabile, ertragreiche und klimaresiliente Bestände aufbauen.
Weitere Informationen unter:
Dieses kostenfreie Tool zeigt für jeden Waldstandort heutige und zukünftige Standortbedingungen bis ins Jahr 2100 (Maßstab 1:25.000).
Es bietet konkrete Empfehlungen für eine standortangepasste, klimafitte Baumartenwahl und es enthält Themenkarten zu Klima, Bodeneigenschaften, Baumarteneignung und Klimawandel.
Dauerhafte Pflege für den Schutzwald
Aufforsten allein reicht nicht. Ein Schutzwald muss über Jahrzehnte hinweg gepflegt werden.
Entscheidende Faktoren
- Freistellen junger Kulturen von Konkurrenzvegetation.
- Nachpflanzen bei Ausfällen im 1.–3. Jahr.
- Schutz vor Wildverbiss (Jagdstrategie, Einzelschutz, Zäune).
- Dokumentation von Pflegemaßnahmen (z. B. digital).
Maßnahme M2 (Waldfonds):* Unterstützt unter anderem die Regulierung der Baumartenzusammensetzung, Kultur- und Jungbestandspflege, Wildschadensvermeidung sowie die Einleitung von Naturverjüngung.
- Förderhöhe: Bis zu 80 % der anrechenbaren Kosten bei mittlerer oder hoher Schutz- bzw. Wohlfahrtsfunktion, sonst 60 %
- Mindestprojektgröße: 1.000 Euro anrechenbare Kosten
- Maximalförderung: 200.000 Euro pro Förderungswerber und Bundesland
*(Stand 08/2025)
© 2025 Adobe Stock, Carmen Hauser
© 2025 Adobe Stock, btPhot
Technischer und biologischer Schutz greifen ineinander
In vielen alpinen Regionen wird die Schutzwirkung des Waldes gezielt durch technische Maßnahmen ergänzt, etwa mit Steinschlagschutznetzen, Lawinenverbauungen oder Steinschlagschutzzäunen. Solche Anlagen kommen vor allem dort zum Einsatz, wo der Schutzwald geschwächt ist oder seine Funktion erst wieder aufgebaut werden muss. Teils dienen sie als temporäre Sicherung, bis die biologische Schutzwirkung des Waldes wiederhergestellt ist.
Empfohlene Vorgangsweise
- Enge Abstimmung mit der Bezirksforstinspektion und der Wildbach- und Lawinenverbauung (WLV)
- Kombination aus Schutzwaldpflege und technischer Sicherung
- Nutzung von Gefahrenzonenplänen zur Priorisierung und Planung der Maßnahmen
- Schutzwaldpflege ist aktiver Risikoschutz: Die Verbindung aus digital gestützter Planung, gezielter Baumartenwahl, kontinuierlicher Pflege und, falls nötig, technischer Sicherung bildet die Grundlage für klimaresiliente Bergwälder.
Für Waldbesitzer:innen bedeutet das: rechtzeitig handeln, Fördermöglichkeiten des Waldfonds nutzen und langfristig planen. Digitale Tools wie der Waldatlas und die Baumartenampel liefern eine fundierte Entscheidungsgrundlage.
Zum Weiterlesen
Zum Nachlesen
Rechte & Produktion
© 2024 Die österreichischen Familienwaldbetriebe & Österreichischer Forstverein – Unterstützt durch den Holzinformationsfonds der Landwirtschaftskammer Österreich
Redaktion
Wir haben sorgfältig recherchiert und Informationen zusammengetragen. Wenn ihnen dennoch etwas auffällt, was sie ändern würden oder etwas zu ergänzen wäre, bitten wir sie, Kontakt mit uns aufzunehmen. Wir freuen uns über ihre Rückmeldung und Anregungen.