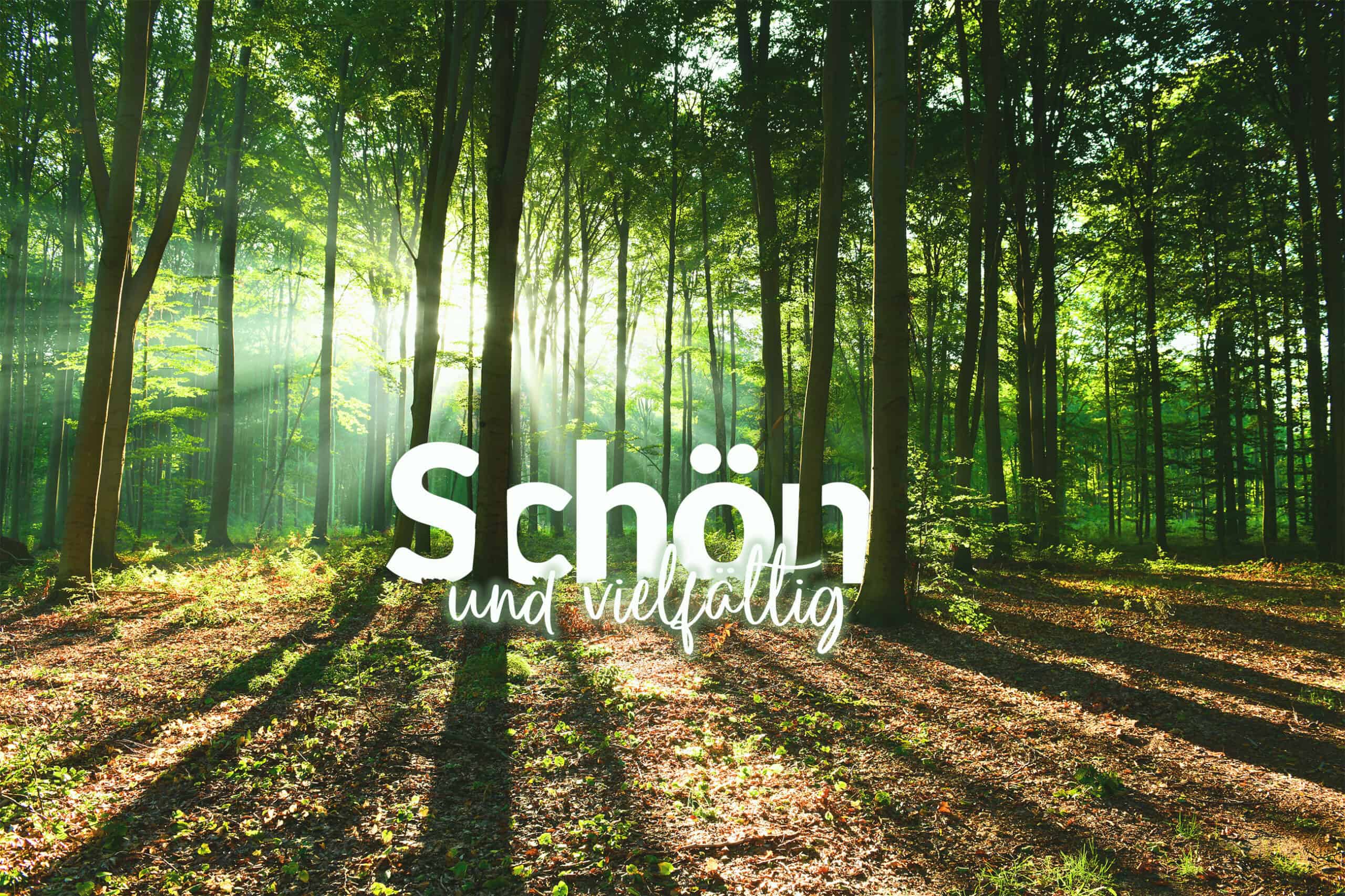© 2025 Adobe Stock, rtwentyseven
Was ist GIS?
GIS steht für Geografisches Informationssystem.
Es ist ein digitales Werkzeug, mit dem räumliche Daten erfasst, ausgewertet und visualisiert werden können – etwa Karten, Luftbilder oder Standortdaten.
In der nachhaltigen Waldbewirtschaftung hilft GIS zum Beispiel dabei:
- Waldflächen zu kartieren,
- Käferbefall oder Sturmschäden zu dokumentieren,
- Erschließungswege oder Rückegassen zu planen oder
- Schutzgebiete digital zu überblicken.
So wird der Wald präziser, effizienter und klimaschonend bewirtschaftet.
© 2025 Adobe Stock, ronstik
Digitale Helfer im Wald – der Stand heute
In Österreich sind GIS längst mehr als nur Landkarten auf dem Bildschirm. Sie sind Werkzeuge zur Analyse, Planung und Entscheidungsfindung. Die wichtigsten Plattformen auf Bundes- und Landesebene – etwa der WALDATLAS des Landwirtschaftsministeriums oder die GIS-Portale der Bundesländer wie z.B. GIS für die Steiermark, VOGIS für Vorarlberg, SAGIS in Salzburg oder Geoland.at stellen eine breite Palette an Geodaten zur Verfügung: Höhenmodelle, Luftbilder, Waldinventuren, Schutzgebiete, Naturgefahrenzonen.
Viele dieser Informationen stammen aus Fernerkundung und terrestrischen Erhebungen und werden regelmäßig aktualisiert. Besonders hilfreich: Die Tools bieten Funktionen zum Messen, Zeichnen und Exportieren – für Forstbetriebe ebenso wie für Planungsbüros, Naturschutz und Bildung.
Auch digitale Standortkartierungen, wie sie an der Universität für Bodenkultur (BOKU) entwickelt wurden, fließen vermehrt in Planungen ein: Sie ermöglichen eine differenzierte Auswahl klimaangepasster Baumarten, basierend auf Boden, Hangneigung, Niederschlag und Temperatur.
Ein weiteres österreichisches Erfolgsbeispiel: die Waldentwicklungspläne WEP-AUSTRIA-DIGITAL. Sie werden in immer mehr Regionen digital erhoben, gespeichert und GIS-gestützt aktualisiert – inklusive Erschließungswegen, Schutzwaldbereichen, Baumartenmischung und Pflegemaßnahmen.
Dazu kommen Schadensanalysen über Plattformen wie AlpMon, ein Projekt mit dem Ziel der Entwicklung eines Konzeptes für ein im Earth Observation Data Centre (EODC) umgesetztes Alpines Wald-Monitoringsystem. Die Naturgefahrenkarten auf hora.gv.at visualisieren Sturmpotenzial, Lawinenrisiken und Hangneigungen – oft entscheidend für Planung, Aufforstung oder Wegeführung im Bergwald.
Wie sieht die digitale Forstzukunft aus?
Die Zukunft von GIS im Wald ist vernetzt, intelligent – und mobil. Schon heute werden Drohnenflüge mit LiDAR-Scans (kurz für “Light Detection and Ranging”, eine Technologie zur Erfassung von Entfernungen und zur Erstellung von 3D-Modellen mithilfe von Laserlicht) oder Multispektralkameras durchgeführt, um Baumhöhen, Kronenzustände und Vitalitätsindizes zu messen.
Erste Projekte in Österreich kombinieren diese Bilddaten mit KI-Algorithmen, um etwa Trockenstress, Schädlingsbefall oder Windwurfzonen automatisiert zu erkennen – unabhängig von menschlicher Interpretation oder bewölktem Himmel.
Parallel dazu entstehen sogenannte “digitale Waldzwillinge”, virtuelle Abbilder von Waldflächen, in denen sämtliche Informationen gebündelt und simuliert werden können: Baumarten, Vorrat, Habitatbäume, Klimarisiken, geplante Hiebsmaßnahmen. Grundlage sind zunehmend auch Sensoren im Gelände: Messgeräte für Bodenfeuchte, Lufttemperatur, Schneelast oder sogar Kameras für Wildbeobachtung. Kombiniert mit GIS schaffen sie ein Echtzeit-Monitoring, das den Blick in den Wald tiefer und präziser macht als je zuvor.
Ein besonderer Fokus liegt auf Open Data: Österreich fördert die freie Verfügbarkeit von Geodaten. Viele Landes-GIS-Plattformen stellen hochaufgelöste Orthofotos, Standortdaten oder Biotopkartierungen kostenfrei bereit. Die Absicht: Auch kleine Waldbesitzer:innen sollen durch einfache Tools von der Digitalisierung profitieren – ohne Spezialkenntnisse oder teure Profisoftware.
.
© 2025 Adobe Stock, grthirteen
© 2025 Adobe Stock, atsuo Studio
Was bringt GIS konkret?
Die Vorteile von GIS in der nachhaltigen Waldbewirtschaftung sind vielfältig:
Klimaanpassung: Mit Standortkarten, Höhenmodellen und Klimadaten können klimaresiliente Mischbaumarten gezielt gefördert werden – eine zentrale Strategie gegen Dürre, Hitze und Schädlingsdruck.
Schutzwaldmanagement: Besonders in Hanglagen und alpinen Regionen sind digitale Naturgefahrenkarten entscheidend. Sie helfen, Erosionsrisiken, Lawinenabgänge und Windwurfzonen präzise zu erfassen und Schutzmaßnahmen besser zu planen.
Biodiversität fördern: Biotopkartierungen und Habitatbaumdaten lassen sich in GIS-Layern abbilden. So kann Rücksicht auf seltene Arten genommen und Naturschutz in die Bewirtschaftung integriert werden.
Monitoring & Transparenz: Vom Einschlag über Pflege bis zur Wiederbewaldung – GIS macht forstliche Maßnahmen nachvollziehbar. Auch für die Kommunikation mit Behörden, Nachbarn oder Öffentlichkeit sind Karten oft hilfreicher als lange Berichte.
Wo liegen die Grenzen von GIS?
Trotz aller Chancen gibt es auch Herausforderungen:
Technische Hürden: Gerade für kleinere Betriebe fehlt es oft an Geräten, Know-how oder Zeit. Zwar gibt es Schulungen und Förderungen – doch nicht jede:r Waldbesitzer:in fühlt sich der Digitalisierung gewachsen.
Datenschutz: Der Schutz sensibler Betriebsdaten ist ein sensibles Thema. GIS-Anwendungen sollten klare Eigentums- und Zugriffsrechte berücksichtigen, um Akzeptanz zu sichern.
Internet im Wald: Viele Anwendungen setzen Netzverbindung voraus – doch im Bergwald ist mobiles Internet oft lückenhaft. Offline-fähige Apps und lokale Datenpuffer bleiben deshalb wichtig.
Standardisierung: Unterschiedliche Datenformate und Kartenlayer erschweren manchmal die landesweite Zusammenarbeit. Hier braucht es gemeinsame Schnittstellen – etwa über das INSPIRE-Programm der EU, einer EU-weiten Richtlinie seit dem Jahr 2007. Sie verpflichtet die EU-Mitgliedstaaten dazu, räumliche Daten, z.B. zu Umwelt, Natur, Infrastruktur, Gefahrenzonen etc.
- einheitlich zu erfassen,
- digital zu standardisieren und
- öffentlich bereitzustellen.
© 2025 Adobe Stock, mdyn
© 2025 Adobe Stock, tibor13
GIS – und jetzt?
Wenn Daten, Praxis und Technik gut zusammenspielen, kann GIS ein Schlüssel für klimafitte, biodiversitätsreiche und nachhaltig bewirtschaftete Wälder sein. In Österreich ist der Grundstein gelegt: Mit Plattformen wie WALDATLAS, Geoland & Co., mit forstlichen Digitalisierungsprojekten und einem starken Fokus auf Schutzwald und Naturgefahren.
Wichtig ist jetzt, auch kleine Betriebe mitzunehmen, digitale Kompetenzen zu stärken und pragmatische Lösungen anzubieten. Denn der Wald der Zukunft wird mithilfe von digitaler Unterstützung nachhaltig bewirtschaftet werden können. Mit Menschen, die wissen, wie man beides zusammen denkt.
Von der digitalen Karte zur realen Waldarbeit
GIS-Technologie kann Borkenkäferbefall erkennen und Sturmschäden kartieren – doch ohne unsere Familienwaldbetriebe bleiben diese Informationen nur bunte Pixel auf dem Bildschirm. Nur Menschen können mit der Motorsäge in den Wald gehen, Bäume fällen und neue pflanzen. Sie kennen jeden Baum, sind bei Wind und Wetter draußen und setzen das digitale Wissen in konkrete Taten um. GIS zeigt, wo gehandelt werden muss – aber nur die Waldbesitzer:innenkönnen handeln. Sie sind das Rückgrat unserer Waldbewirtschaftung und verwandeln Daten in Taten.
Zum Weiterlesen
Zum Nachlesen
Rechte & Produktion
© 2024 Die österreichischen Familienwaldbetriebe & Österreichischer Forstverein – Unterstützt durch den Holzinformationsfonds der Landwirtschaftskammer Österreich
Redaktion
Wir haben sorgfältig recherchiert und Informationen zusammengetragen. Wenn ihnen dennoch etwas auffällt, was sie ändern würden oder etwas zu ergänzen wäre, bitten wir sie, Kontakt mit uns aufzunehmen. Wir freuen uns über ihre Rückmeldung und Anregungen.