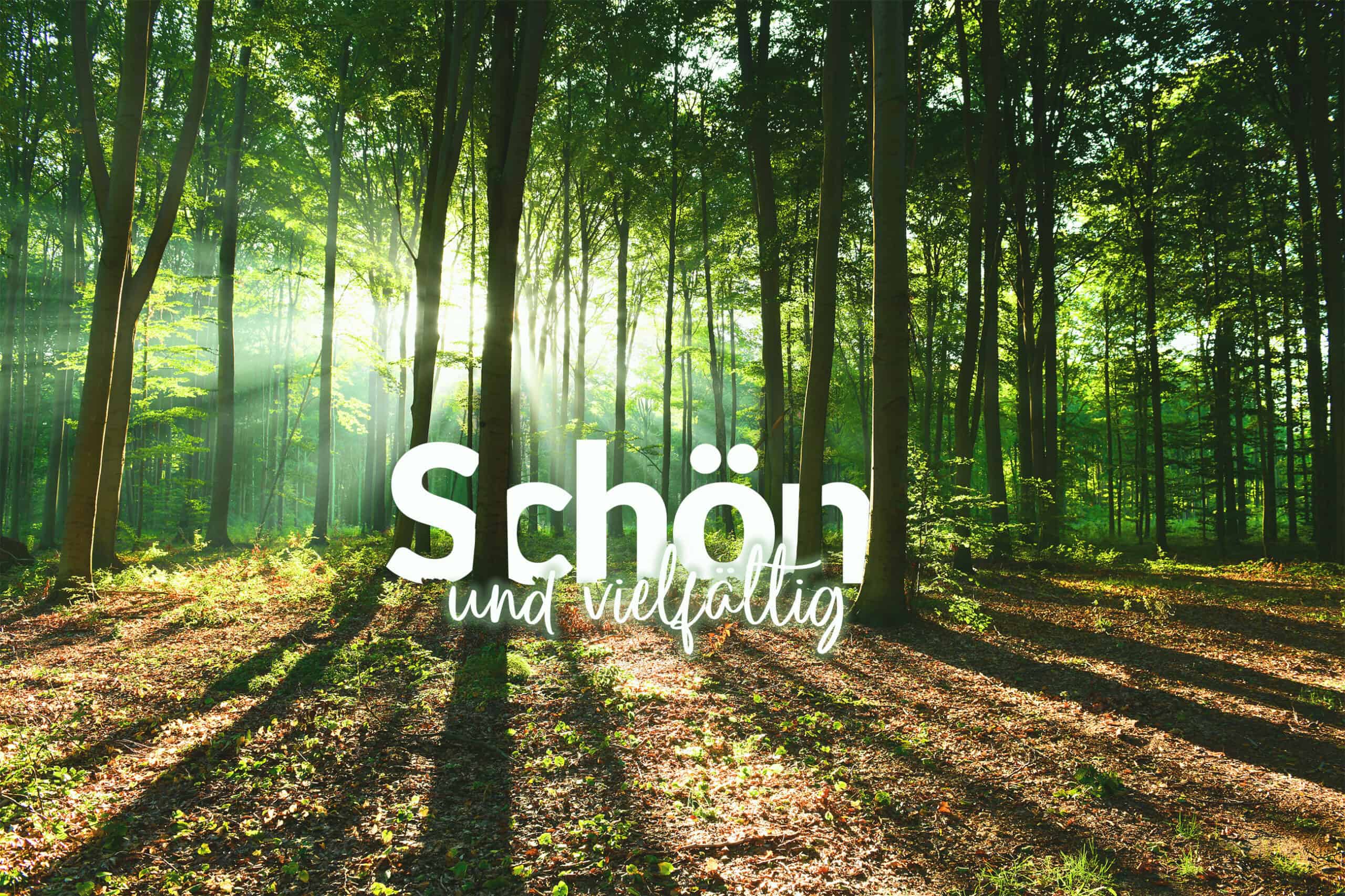© 2025 Adobe Stock, magann
Tiny Forest – die ursprüngliche Idee
Miniwälder basieren oft auf der sogenannten Miyawaki-Methode. Der japanische Forstexperte und Vegetationskundler setzte bereits in den 1970er-Jahren auf eine Aufforstung sehr kleiner Flächen mit standortheimischen Bäumen und Sträuchern.
Eine hohe Pflanzdichte soll die Pflanzen zu schnellerem Wachstum zwingen und die Verwendung vieler unterschiedlicher Arten robuste, artenreiche Bestände fördern. Nach Miyawakis Tiny-Forest-Konzept entstanden ab den 2010er-Jahren Biotope in den Städten in Niederlanden, Großbritannien, in Deutschland und anderen Ländern.
© 2025 Dr. Andrea Kodym
Miniwald heute: Was macht heute in Österreich einen Miniwald aus?
„Miniwälder haben meist eine Größe unter 500 m²“, erklärt Dr. Andrea Kodym. Zur Einordnung: Ab einer Fläche von 1.000 m² und einer Durchschnittsbreite von 10 Metern, bepflanzt mit Forstpflanzen, gilt sie nach dem österreichischen Forstgesetz als Wald.
Der Miniwald, den Dr. Kodym mit ihrem Team beim Kreisverkehr in Wiener Neustadt erforscht, misst 450 m² und beherbergt 30 verschiedene Pflanzenarten, darunter Feldulme, Wildbirne und Steinweichsel. Der kleinste von ihnen errichtete Miniwald in einem Gemeindebau im 4. Wiener Bezirk beläuft sich auf 135 m².
Wofür ist ein Miniwald gut?
Miniwälder stellen eine vielversprechende alternative Form der Stadtbegrünung dar, die insbesondere im Hinblick auf Klimawandel und Biodiversitätsverlust ein enormes Potenzial bieten.
Kühlung und Mikroklima
Ein Miniwald senkt die lokale Temperatur und sorgt für angenehmeres Mikroklima. Dies ist besonders in Städten wertvoll, um die Auswirkungen von Hitzewellen abzumildern.
Verbesserter Wasserrückhalt
Der Boden eines Miniwaldes speichert Wasser und reduziert so Oberflächenabfluss. Dies hilft Überflutungen zu verringern, insbesondere in stark versiegelten Gebieten und bei zunehmend häufigen Starkregen-Ereignissen.
Lebensraum für Tiere und Pflanzen
Miniwälder bieten eine vielfältige Struktur und somit Zuflucht für Vögel, Insekten und kleine Säugetiere. Sie erhöhen die Biodiversität in städtischen Gebieten, die oft artenarm sind. Als Trittsteinbiotope vernetzten sie ansonsten isolierte Lebensräume.
Kohlenstoffbindung
Miniwälder nehmen CO₂ aus der Atmosphäre auf und speichern es langfristig. Dies hilft, die Auswirkungen des Klimawandels zu mindern.
Luftreinigung
Die dichte Vegetation filtert Schadstoffe aus der Luft und verbessert die Luftqualität.
Sozialer Raum
Miniwälder können als Bildungs- und Begegnungsorte genutzt werden, um das Bewusstsein für Umweltschutz und nachhaltige Forstwirtschaft zu stärken: Schulen nutzen sie als Freiluftklassenzimmer oder Nachbarschaften als gemeinsames Projekt, das das Umweltbewusstsein stärkt und Menschen miteinander verbindet.
© 2025 Adobe Stock, romikmk
© 2025 Cecilie Foldal
Das wird am Bundesforschungszentrum für Wald BfW erforscht
Bisher legte das Team um Dr. Andrea Kodym vier Miniwald-Flächen mit Forschungshintergrund* an. Zwei davon befinden sich in Niederösterreich (Schwechat und Wr. Neustadt) und zwei in Wien (eine in einem Gemeindebau und eine an der HBFLA-Gartenbauschule Schönbrunn). Die Wissenschaftler:innen untersuchen die Auswirkungen auf das Mikroklima und die Artenvielfalt von Wildbienen, Laufkäfern und Begleitvegetation. Sie prüfen die tatsächliche Höhe der Kohlenstoffbindung sowie Akzeptanz und Nutzung durch die Bevölkerung.
Ein wesentlicher Punkt ist auch die Frage, welche Pflanzenarten sich für eine Miniwald Anpflanzung besonders eignen. Außerdem wurden Herkünfte aus Ungarn verwendet, um zu testen, ob sie besser mit den heißen und trockenen Sommern zurechtkommen als das regionale Pflanzmaterial. Die Versuchsflächen wurden im Winter 2024 und Frühjahr 2025 angelegt und die ersten Ergebnisse werden für Winter 2025 erwartet.
Der Miniwald wird anfangs eingezäunt, bei Trockenheit moderat bewässert und die Beikräuter durch Niedertreten klein gehalten, wobei keine Biomasse entnommen wird. Nach ca. drei Jahren wird er sich selbst überlassen.
Erste Eindrücke sind hier zu finden.
* Die Forschungsprojekte werden über DaFNE mit Mitteln des BMLUK und Wiener Wohnen finanziert.
Selbst einen Miniwald anlegen
In Österreich unterstützen manche Gemeinden solche Projekte im Rahmen von Klimaanpassungsstrategien. Besonders erfolgreich sind Initiativen, wenn Schulen, Vereine oder Nachbarschaften eingebunden werden, da die Pflege in den ersten Jahren entscheidend ist.
Ein Miniwald kann zwar keine großen Waldflächen ersetzen, doch er trägt im urbanen Raum dazu bei, Umwelteffekte positiv zu beeinflussen und die Bedeutung von Wäldern sowie ihren ökologischen Funktionen stärker ins Bewusstsein zu rücken.
© 2025 Adobe Stock, maxbelchenko
Zum Weiterlesen
Zum Nachlesen
Rechte & Produktion
© 2024 Die österreichischen Familienwaldbetriebe & Österreichischer Forstverein – Unterstützt durch den Holzinformationsfonds der Landwirtschaftskammer Österreich
Redaktion
Wir haben sorgfältig recherchiert und Informationen zusammengetragen. Wenn ihnen dennoch etwas auffällt, was sie ändern würden oder etwas zu ergänzen wäre, bitten wir sie, Kontakt mit uns aufzunehmen. Wir freuen uns über ihre Rückmeldung und Anregungen.